Im Spätsommer 1932 werden die Weichen für den Einsatz des weiblichen Arbeitsdienstes in Siedlungen gestellt. Die bis heute gängige Darstellung, wie es dazu kam, ist allerdings unvollständig, wichtige Details wurden nie hinterfragt.
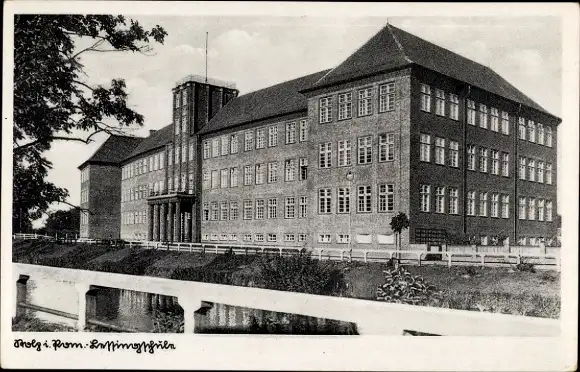
Stolp im August 1932
Vorbemerkung: Im vorangegangenen Kapitel fand teilweise bereits ein Vorgriff bis in den Herbst 1932 hinein statt, insbesondere deshalb, weil Texte, die im Frühjahr und Sommer des Jahres geschrieben wurden, teilweise erst einige Monate später erschienen, jedoch im zeitlichen Zusammenhang ihrer Entstehung vorgestellt wurden. Bei der Frage nach der Verbindung von Siedlungsberatung und Arbeitsdienst wurde außerdem mit der Einführung der Person Elisabeth Eckerts vorgegriffen, deren Stunde jedoch erst im August 1932, worauf im Folgenden eingegangen wird, schlägt.
Zunächst zurück in der Chronologie und zu Herman Nohl, der Anfang August 1932 erneut in Pommern zu Besuch ist. Anlässlich einer Tagung des Fröbelverbandes in Verbindung mit der Lessing-Schule (Lyzeum und Frauenschule) in Stolp schließt er sich einer Rundfahrt an, die Thea Iffland mit Irmgard Delius durch eine Reihe ostpommerscher Siedlungen unternimmt.1 Diese Fahrt führt an zwei Tagen (10. und 11. August 1932) zunächst von Stolp aus über die Orte Schlawe2, Wendisch Puddiger3, und Barvin4 zurück nach Stolp und am nächsten Tag nach Klein Podel5, insgesamt 169 Kilometer mit dem Auto.6
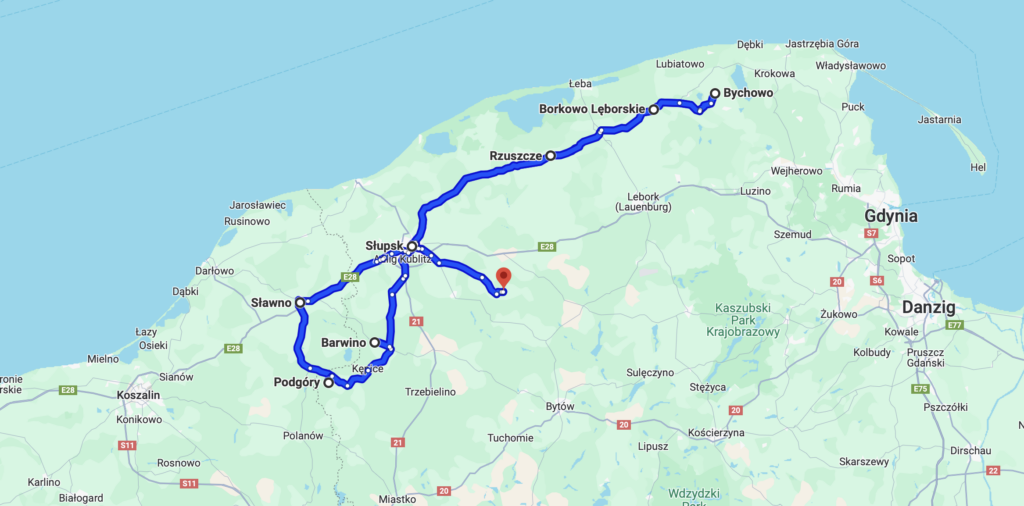
Herman Nohl wird später irritiert davon sein, dass er für diese Reise einen Beitrag zu den Fahrtkosten i.H.v. 10 Pfennig je Kilometer bezahlen soll, doch Aenne Sprengel bittet ihn um “Verständnis dafür, daß wir die verschiedenen Persönlichkeiten, die sich für die Arbeit unserer Siedlungshelferinnen interessieren, nicht kostenlos mitnehmen können. Die Mittel sind doch recht beschränkt […].”7 Seit der ersten Fahrt im Winter, nicht einmal ein halbes Jahr zuvor, scheint das Interesse an einer Besichtigung der Siedlungen in diesem Teil des Landes gestiegen zu sein.
Die sich an den Ausflug anschließende Tagung von Freitag, 12. bis Sonntag, 14.8.1932, steht unter dem Motto Die volkserzieherischen Aufgaben der Frau auf dem Lande und in der Siedlung. Sie bringt “alle Kräfte […], die in der Provinz Pommern in der Jugendwohlfahrtspflege und in der Volkserziehung stehen, insbesondere Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen, Jugendleiterinnen, Lehrer und Lehrerinnen, Geistliche, Jugendpfleger und Jugendpflegerinnen, Wohlfahrtspflegerinnen, Siedlungshelferinnen, Gemeindeschwestern” zusammen.8 Die Genese dieser Tagung lässt sich im Briefwechsel Hildegard von Gierke – Herman Nohl sehr gut nachvollziehen.9 Anfang Juni 1932 meldet sich Hildegard von Gierke zunächst bei Nohl, um dessen Beiträge zur Veranstaltung abzustimmen, Nohl selbst hat offenbar schon Ende Mai Titel und Tagungsort vorgeschlagen.10 Das vom Fröbelverband ausgearbeitete Programm sieht vor, dass Vertreter:innen der diversen in Pommern engagierten Einrichtungen – neben den Berliner Ministerien und der Landwirtschaftskammer in Stettin vor allem die im weitesten Sinne ehrenamtlich Tätigen innerhalb von Kirche und Frauenvereinen, sowie aus den Berufsorganisationen der Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen und Jugendleiterinnen – sich zum aktuellen Stand der Entwicklungen in den Siedlungen austauschen.
Herman Nohl schlägt Thea Iffland als Referentin vor, “die sich hier [gemeint ist das Thema der Tagung, S.G.] besser auskennt als irgend eine andere”.11 Für einen Vortrag zum Thema Dorfgemeinschaft fällt ihm Hans Fuchs ein, “der ausgezeichnet spricht und ein ungemein angenehmer Mensch ist”. Dessen Erfahrungen in der Siedlung Jablonken würden ihn für das Thema prädestinieren.12 Es soll außerdem über Einrichtung und Ausgestaltung der Kinderfürsorge und über Elternschulung durch die Praxis gesprochen werden, wofür Irmgard Delius und Ursula Zielke, Leiterin des Kindergärtnerinnenseminars in Stolp, ins Spiel gebracht werden.13 Auch Elisabeth Blochmann soll sprechen – zur Zusammenarbeit von Schule, Jugendwohlfahrtspflege und Elternhaus.
Aus zwei im Anschluss veröffentlichten Tagungsberichten erfährt man, welche Vorträge am Ende realisiert wurden.14 Einleitend spricht demnach der Landrat von Bütow, Walter Springorum15, zum augenblicklichen Stand der Siedlungsfrage, dann Walter Nowack aus Bütow16, der “auf die hauswirtschaftliche Schulung der jungen Mädchen” eingeht, bevor Thea Iffland die Arbeit der bisher eingesetzten neun Siedlungshelferinnen vorstellt. Sie berichtet, dass diese in den Dörfern “in allen Dingen um Rat gefragt [werden], und es kann ein starker volkserzieherischer Einfluß von ihnen ausgehen”.17 Eine Aussprache beschließt den ersten Teil der Veranstaltung. Im zweiten Teil der Tagung, die sich insbesondere an die in der praktischen Arbeit stehenden Teilnehmer:innen, d.h. die “Siedlungshelferinnen, Fürsorgerinnen, Jugendleiterinnen, Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen, Lehrer” wendet, sind weitere Vorträge angesetzt:
Der Medizinalrat Dr. Peiper spricht über die gesundheitliche Betreuung der Landkindergärten, basierend auf seinen Erfahrungen im Kreis Bütow, Zitat: “Der Wert der Arbeit liegt vor allem in der Erziehung der Mütter, die nur durch unermüdliche Kleinarbeit und Beispiel zu erziehen sind.”18 Irmgard Delius präsentiert die bis dahin in Erntekindergärten gewonnenen Erkenntnisse und betont den “Einfluß, der von einer solchen Einrichtung auf das Familienleben ausgeht”:
In der Aussprache ergab sich, daß da, wo Siedlungshelferinnen das ganze Jahr über im Dorf bleiben, ein drei- bis viermonatiger Erntekindergarten unter Umständen mit Schülerinnen durchgeführt werden kann, daß dagegen in anderen Dorfgemeinschaften die Dauerstellung einer sozialpädagogischen Kraft wünschenswert sei, die dann durch die Fühlungnahme mit den Eltern der Kinder ihre Aufgabe im Sinne der Siedlungshelfer [sic!] erfüllen kann.19
Die Leiterin der Mädchenklasse der Landwirtschaftsschule in Stolp namens Posega, spricht zum Thema ländlich-hauswirtschaftliche Frauenbildung und wirft die Frage nach der Zuständigkeit für den Unterricht für ältere Mädchen in den Siedlungen auf, da bspw. im Bezirk Köslin für diese noch keine Fortbildungsschule bestehe. Rudolf Spittel, Pfarrer in Stolp stellt die Arbeit der Jugendpflegerin vor, die durch die Kirche für seinen Bezirk angestellt wurde.20 Elisabeth Blochmann führt den Zuhörer:innen in ihrem Referat mit dem Titel Schule, Jugendwohlfahrt und Elternhaus die “Gegensätzlichkeit der sozialen Arbeit in der Stadt und auf dem Lande” vor Augen und verortet die Tätigkeit der Siedlungshelferin in diesem Kontext:
Die neue Möglichkeit ergibt sich in der Arbeit auf dem Lande für die Frau, uneingeengt von dem Gehäuse eingefahrener Gewohnheiten, frisch aus den vielgestaltigen Aufgaben des Augenblicks Leben zu bewältigen. Diese Aufgabe fordert ein starkes hoffnungsfreudiges Menschentum.21
Herman Nohl selbst steuert zwei Vorträge zu der Tagung bei, die beide vermutlich als öffentliche Veranstaltung stattfinden. Den Vortrag Die volkserzieherische Arbeit innerhalb der pädagogischen Bewegung veröffentlicht er anschließend mehrfach, zum ersten Mal im März 1933 – unter veränderten politischen Vorzeichen – in der Erziehung.22 Elisabeth Blochmann, die selbst in Stolp dabei war, spricht in ihrer 1969 erschienenen Biografie Nohls, mithin mehr als 35 Jahre und eine NS-Diktatur später, davon, dieser Vortrag sei Ausdruck einer damaligen “Kampfstellung” Nohls gewesen – sie meint einen Kampf für “die humanitäre Zielsetzung seiner Pädagogik”.23 Dem muss widersprochen und der Vortrag genauer vorgestellt werden, weil sich in ihm – mit Benjamin Ortmeyer gesprochen – “die zentrale Passage Nohls zum Nationalsozialismus vor 1933” findet.24 Die folgende Analyse basiert auf den beiden 1933 veröffentlichten Texten, es muss ungeklärt bleiben, ob diese tatsächlich dem entsprechen, was Nohl ein halbes Jahr zuvor vorgetragen hat.25
Die volkserzieherische Arbeit innerhalb der pädagogischen Bewegung
Die Grundfrage, die Herman Nohl mit seinen Ausführungen klären will lautet: “Welche große neue Aufgabe ist dieser [pädagogischen, S.G.] Bewegung heute gestellt und was kann unsere pflegerische Arbeit dafür leisten, und nur sie leisten?”26 Zunächst also dazu, was Nohl als “Aufgabe der pädagogischen Bewegung” vorstellt. Seine Ausführungen drehen sich zentral um das sog. Phasen-Modell – da ich mich eingangs dazu entschieden habe, nicht grundsätzlich auf Herman Nohls pädagogische Theorie einzugehen, wurde dieses Konzept bisher nicht vorgestellt. Zusammenfassend daher die wichtigsten Aspekte nach Benjamin Ortmeyer:
Der durchgehende Zug in Nohls Schriften ist die Denkfigur der „polaren Gegensätze in der Erziehung“. Nohl benennt in seinen Analysen immer zwei Seiten des pädagogischen Problems: das Individuum (das Subjektive fördern) einerseits und objektive Anforderungen (der Gemeinschaft genügen) andererseits. Freier Wille einerseits und Erziehung zum Gehorsam andererseits usw. Die Akzentsetzung, so seine Grundthese, sei Sache der „geschichtlichen Stunde“, mal sei dies mehr betont, mal jenes, aber keines dieser gegensätzlichen Elemente dürfe übersehen werden. Und wenn doch, dann nur vorübergehend, aufgrund der so genannten „geschichtlichen Stunde“.27
Zum “Phasen-Modell”:
“Jede pädagogische Bewegung verläuft in drei Phasen – das ist ihr Gesetz“. […] Der zentrale Begriff der ersten Phase ist für Nohl „Persönlichkeit“, der der zweiten Phase die „Gemeinschaft“. Zur dritten Phase, die ja bekanntlich die zweite und dritte Phase „in sich aufhebt“, führt Nohl aus: „Das Schlagwort dieser dritten Phase ist nicht mehr Persönlichkeit und Gemeinschaft, sondern ‚Dienst‘, d. h. die tätige Hingabe an ein Objektives.“28
Hier nun setzt also der Vortrag in Stolp an, Nohl fasst die jeweiligen Charakteristika dieser drei von ihm als typisch angesehenen Phasen zusammen und stellt dann Friedrich Fröbel als Repräsentant einer dritten Phase vor. Für diesen sei Erziehung per se Nationalerziehung gewesen – im Sinne einer Synthese von a) Abgrenzung zu dem was “abgelegt scheint” (erste Phase, repräsentiert z.B. durch Locke und Rousseau im 18. Jahrhundert und Nietzsche im 19. Jahrhundert) und b) der Ausweitung des in der ersten Phase nur für Einzelne Errungenen auf die Masse (zweite Phase, repräsentiert von Pestalozzi im 18 . Jahrhundert und der sozialpädagogischen Bewegung seit Ende des 1. Weltkrieges).29 Die Nationalerziehung, wie Fröbel sie gefordert habe, sei als Ausdruck einer dritten Phase die Bündelung der in der zweiten Phase in der Masse geweckten Kräfte in eine bestimmte Richtung, die Einbindung des Individuums in ein größeres Ganzes. Es gelte nun wiederum Fröbel nachzueifern, der die pädagogische Aufgabe mit dem nationalen Ziel zusammen geführt habe, denn:
Sehen wir nun wieder auf die pädagogische Bewegung unserer Generation, so ist offensichtlich, daß auch hier jene dritte Phase begonnen hat, die wieder nach Gehalt und Richtung der Kräfte verlangt. Das erscheint oft wie bloße Reaktion, in Wahrheit aber ist immer das überlegene Ganze gemeint mit seiner objektiven Gewalt, das die individuellen Kräfte in Anspruch nimmt und die egoistischen in einer großen Verpflichtung bindet.30
Die Frage, die sich stellt ist, wieso – wenn doch, wie Nohl selbst sagt, Fröbel einer vorangegangenen Abfolge von Phasen angehörte – dieser jetzt erneut der bestimmende Theoretiker sein soll, oder ob nicht vielmehr analog zu Fröbel ein anderer diese Rolle einnehmen müsste. Nohl lässt eine solche Überlegung nicht zu und es bieten sich unterschiedliche Erklärungsansätze dafür an, wieso nicht:
- Nohl ist zu sehr auf Fröbel fixiert, um zu erkennen, dass ein “neuer Fröbel” identifiziert werden müsste.
- Nohl will keinem seiner Fachkollegen diese Rolle zusprechen.
- Nohl sieht sich selbst in der Position, der “neue Fröbel” zu werden.
- Nohl “trommelt” für einen noch nicht in Erscheinung getretenen, antizipierten Dritten.
Vor allem der letzte Erklärungsansatz wäre in seiner Bedeutung höchst kritisch, bedenkt man, dass Adolf Hitler in seinem Buch Mein Kampf und in den Anfangsjahren seiner politischen Karriere von sich selbst als einem Trommler für den kommenden Führer sprach, dem er den Weg bereiten wollte.31 Aber zurück zu den Inhalten des Vortrags. Die Basis für eine neue nationale Pädagogik bildeten auch in der Gegenwart – wie bei Fröbel 120 Jahre zuvor – der “Geist”, die Familie und die Frau, erklärt Nohl. Es folgt das Zitat, das Benjamin Ortmeyer zufolge “nach 1945 [zum] Anlass heftiger Debatten über die Haltung Nohls zum Nationalsozialismus” wurde.32 Vereinfacht gesagt positioniert sich Nohl dem Nationalsozialismus gegenüber nicht ablehnend, der relevante Abschnitt lautet:
In der Gegenwart, wo die meisten alles von Wirtschaft und Politik erwarten, ist es für jeden Erzieher entscheidend, daß er sich tapfer und unabdingbar auf diesen Standpunkt des Geistes stellt, der nicht bloß für den einzelnen gilt, sondern auch für das ganze Volk. Was die Jugend heute am Nationalsozialismus begeistert und jeder Erzieher in ihm bejahen muß, auch wo er seiner agitatorischen Praxis, seiner Methode der Gewalt und seiner materialistischen Rassetheorie ablehnend gegenübersteht, ist, daß jenseits des politischen Tageskampfes auch er die seelischen und geistigen Kräfte als die entscheidenden gegenüber Wirtschaft und Politik erkennt und die Aufgabe der Zeit wieder als eine große Erziehungsaufgabe sieht: die Form des Menschen und des Volkes muß zuerst von innen her eine andere werden.33
Der Nationalsozialismus, so kann man Nohls Gedankengang zusammen fassen, will das schaffen, was in der jetzt beginnenden “dritten Phase” der pädagogischen Bewegung ansteht, nämlich die Bündelung der bereits freigesetzten Kräfte für ein größeres Ziel, wobei die sozialpädagogischen Ansätze der zurückliegenden zweiten Phase transzendiert werden. Und das ist gut, findet Nohl, das muss man unterstützen, auch wenn man andere Aspekte des nationalsozialistischen Programms ablehnt – und er sagt explizit nicht, dass er das tut, sondern bleibt vage, spricht in der dritten Person! Benjamin Ortmeyer schreibt dazu:
Es ist im Kern die Position, mit der später Hindenburg, trotz ähnlicher Kritiken, Hitler das Kanzleramt übergab, ohne mit der NSDAP in jedem Punkt im Detail einverstanden zu sein. Dies ist ein Dokument des Bündnisses und des Bündnisangebotes der deutschnationalen reaktionären Bewegung mit und an die NS-Bewegung auf der pädagogischen Ebene.34
Nohl erkläre, so Ortmeyer weiter, dass die – von ihm explizit aufgeführten – Einwände gegenüber dem Nationalsozialismus weniger wichtig seien als dessen richtige Vorstellung davon, wie die Gesellschaft wieder geordnet werden könne.35 Dieser These schließe ich mich an, insbesondere weil aus der Publikationsgeschichte des Aufsatzes klar erschlossen werden kann, dass Nohl sich eben gerade nicht gegen den Nationalsozialismus stellen wollte. Nicht nur liegt die Publikation des Textes nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten und es muss ungeklärt bleiben, wie sich Nohl ein halbes Jahr zuvor tatsächlich geäußert hat, im Nachwort zu der Aufsatzsammlung, die seine 1932 veröffentlichten Texte enthält, erschienen im Frühjahr 1933, artikuliert Herman Nohl zudem die Hoffnung, dass “die neue Leitung unseres Volkes [die Aufgabe im ländlichen Osten] jetzt in ihre starke Hand nehmen und diese pädagogische Arbeit […] wirkungskräftig machen [möge].” Und er stellt mit einiger Bewunderung fest, dass “vieles von dem, um das die pädagogische Bewegung […] gerungen hat, […] plötzlich in greifbare Nähe gerückt” sei – und zwar dadurch, dass “die politische Macht […] mit einem Schlag die äußere Einheit des Willens verwirklicht [habe], die die elementare Voraussetzung auch der nationalen Erziehung ist”.36 Und falls das nicht deutlich genug sein sollte, führt Nohl weiter aus:
Daß die Potestas eine eminent pädagogische Bedeutung hat, ist dem, der es noch nicht wußte, jetzt auf das großartigste offenbart worden, wenn auch wohl niemand die hemmungslose Wucht dieser “Gleichschaltung” der Herzen und der Hirne geahnt hat. Die Überwindung des Partikularismus in jeder Gestalt und eine neue Volkswerdung sind jedem sichtbar.37
Dieser Kommentar wäre nicht notwendig gewesen und zeigt, dass Nohl, bei der Drucksetzung seiner Aufsatzsammlung, zumindest einen Teil der durch die Nationalsozialisten initiierten Maßnahmen gut heißt und in ihnen den Auftakt für weitere Entwicklungen sieht, die, um Bestand zu haben, durch pädagogische Bemühungen unterstützt werden müssen.38
Care Arbeit in den Siedlungen?
Nohls Vortrag vom August 1932 beinhaltet neben diesen vielfach analysierten Stelle eine direkte Aussage zum Freiwilligen Arbeitsdienst, die bisher weniger Beachtung gefunden hat, er stellt die These in den Raum, dass dieser aktuell als “Zelle neuen Lebens” im Gegensatz zur Familie konstruiert werde, dabei sei auch für eine solche Organisation zunächst die “Blutsgemeinschaft und Schicksalsverbundenheit der Familie” grundlegend.39 Nohl greift sein nun schon bekanntes Argument auf, dass die Familie als Kern der Gesellschaft wiederum durch die Frau und Mutter geprägt werde und diese daher Unterstützung benötige:
In dem Existenzkampf unseres Volkes wird es entscheidend sein, ob der weibliche Sinn, diese besondere Kraft der größeren und besseren Hälfte unserer Nation, zu reicherer Entfaltung und zu ihrer vollen Macht im ganzen deutschen Volksleben gelangt.40
Diese Aussage darf nicht als feministische oder emanzipatorische Forderung missverstanden werden, die “Entfaltung”, von der Nohl spricht, bezieht sich lediglich auf eine begrenzte Sphäre, Nohl kritisiert, dass die Frauenbewegung, deren Ziel die “Entwicklung der geistigen Selbstständigkeit der Frau und ihre neue Einordnung in die veränderten sozialen Verhältnisse” sei, darüber “die spezifische Frauenaufgabe, die Aufzucht des neuen Geschlechts der Mädchen und Knaben in der Form des häuslichen Lebens und den Aufbau dieses häuslichen Existenz” vergessen habe.41 Die “bessere Hälfte” ist insofern wörtlich zu verstehen, als dass die Frau bei Nohl ihren klar definierten Platz in der Gesellschaft hat, der separat von der männlichen Seite des Lebens mit ganz eigenen Aufgaben gefüllt ist – den sie möglichst nicht verlassen soll bzw. nur dann, wenn sie darüber diese eigentlichen Aufgaben nicht vernachlässigt oder durch die Umstände dazu gezwungen wird, sie zu vernachlässigen. Damit es nicht dazu kommt, soll “die Frau” jede mögliche Unterstützung erhalten.
Nohl ist selbstverständlich klar, dass die Freiheiten, die Frauen in den zurückliegenden Jahren errungen haben, nicht rückgängig gemacht werden können und er will dies auch nicht, sagt er, es ist ihm aber wichtig, den Wert der “eigenste[n] Aufgabe der Frau” innerhalb der Gesellschaft an[zu]heben, um “die Frauen- und Mutterkraft in unserem Volk zu steigern.”42 Entsprechend dieser Forderung führt er weiter aus, dass die Aufgabe der Siedlungshelferin als eine genuin weibliche betrachtet werden müsse, da diese nicht nur landwirtschaftliche Sachverständige sei, “sondern […] in ihrem Dorf wie eine Mutter höherer Observanz, Haus-, Stall- und Gartenwirtschaft, Kindererziehung, Krankenpflege und Fürsorgeberatung, alles in einem, verstehen und überall unmittelbar helfend eingreifen muß.”43 Sie tut das, das wird deutlich, aus der Güte ihres Herzens heraus, oder, mit den Worten Nohls, “aus dem tragenden Bewußtsein […] dem großen Vaterlande zu dienen”.44
Und damit sind wir bei der Feststellung angekommen, dass Herman Nohl die Hilfe für die Siedlerinnen als einen “Dienst” versteht. Diese Formulierung bringe, so Heinrich Kreis,”in besonderer Weise die nationalpädagogische Verantwortlichkeit der Pädagogik allgemein und das Selbstverständnis des Menschen zum Ausdruck […], der sich in sozialer Verantwortung mithilfe des erworbenen Kenntnisstandes und aufgrund seiner Kompetenz zur Lebensführung engagiert”.45 Aus einer anderen Perspektive, wenn man heutige Diskussionen zur Bedeutung von Sorgearbeit und die Frage der Abwertung weiblicher Arbeit mit einbezieht, ergibt sich jedoch ein anderes Bild, nicht zum ersten Mal wird der Anspruch an die Siedlerberaterin deutlich: Sie soll, als bestens ausgebildete Expertin, letztlich eine ideelle Arbeit verrichten.
Die Zusammenkunft in Stolp sei ein voller Erfolg gewesen, berichtet Nohl etwa drei Wochen später an seinen Freundeskreis:
Sie war ein unbedingter Sieg der Siedlungshelferinnen, die geschlossen da waren und beglückend und alle überzeugend, wenn sie bescheiden-stolz von ihrer Arbeit sprachen. Die Auswirkung der Tagung ist auch bereits vorzüglich: neue Helferinnen werden eingestellt, das Ministerium bewilligt Geld für die Kindergarteneinrichtung und hat sich auch in einer Beratung einverstanden erklärt, den freiwilligen Arbeitsdienst dafür einzusetzen.46
Im Anschluss an die Stolper Tagung fährt Nohl direkt weiter nach Ostpreußen, genauer nach Jablonken, an die Wirkungsstätte von Hans Fuchs, wo sich sein Mitarbeiter am Göttinger Seminar, Curt Bondy, mit einer Gruppe von Studenten zur Erntehilfe und zum Studium der masurischen Siedler aufhält.47 Bondy hat im zurückliegenden Semester den Arbeitsdienst als pädagogisches Thema in einem Seminar bearbeitet und ist anschließend zur praktischen Erprobung der eigenen Thesen zum Ernteeinsatz nach Masuren gekommen.48 Nohl berichtet von seinen Erlebnissen an die Empfänger:innen des Rundbriefs:
Die Studenten bewährten sich sehr – im Gegensatz zu andern Unternehmungen bündischer Jugend, die in der Nähe scheiterten – und es war schön, wie dankbar die Siedler für die Hilfe waren und lustig zu sehen, wie die Jungen den Pflug führten oder zu zweit mähten oder die Kühe hüteten. Sie haben auch technisch viel gelernt, so anstrengend es auch für sie gewesen ist. Das Ergebnis soll eine kleine Broschüre werden.49
Nohl scheint aus mehreren Gründen nach Ostpreußen gefahren zu sein. Anlässlich seines Besuches in Jablonken bespricht er mit Hans Fuchs die Gründung einer neuen Zeitschrift, Arbeitstitel Der Osten. Zeitschrift für Landschule und Landkultur, auch dieses Projekt wird im “Brief an die Freunde” erwähnt:
Ob ich mich damit wirklich belasten darf? Und ob wir die Menschen dafür haben und selbst produktiv genug sind? Die Zeit fordert heut so viel von einem und gibt so große Möglichkeiten gerade für die Erziehung bei der gewaltigen Konzentration unseres Volkes in diesen Monaten – man müßte ganz anders zupacken können! Aber wer von Euch hilft?50
Pädagogik, so wie Nohl und sein Kreis sie vertreten, wird als politisches Instrument verstanden, Nohl glaubt, dass die Gelegenheit günstig ist, um sich aktiv in die Lösung der aktuellen gesellschaftlichen Probleme einzubringen – der “Freundeskreis” dient ihm dabei als Rekrutierungsinstrument, oder wie er Ende 1932 an Helene Weber schreibt:
Alll [sic!] unser Tagen hat ja nur einen Sinn, wenn es gelingt, die dabei wirksam hervorgetretenen Persönlichkeiten an die richtige Stelle zu bringen und mit den richtigen Aufgaben zu betrauen.51
Aenne Sprengel und Elisabeth Eckert treffen (wahrscheinlich) zusammen
Generell scheint sich die Aktivität Herman Nohls wie der anderen am Projekt “Siedlerinnenhilfe” Beteiligten jetzt mehr und mehr auf Tagungen und Arbeitskreissitzungen zu verlagern, es wird nicht mehr nur im kleinen Kreis bzw. bi- und trilateral geplant. Und damit kommen wir zu der Zusammenkunft, die später als inaugurales Moment zum weiblichen Arbeitsdienst kolportiert wird: Eine Tagung pommerscher Pfarrer, nach Angabe Elisabeth Eckerts, “Anfang August” 1932. Dort treffen – so Elisabeth Eckert weiter – sie selbst und Aenne Sprengel zum ersten Mal zusammen und dort nimmt demnach die Idee Gestalt an, den weiblichen Arbeitsdienst in der Siedlerinnenberatung einzusetzen.52 Wie im vorangegangenen Kapitel erwähnt, leitet die 27jährige Elisabeth Eckert zu diesem Zeitpunkt ein Arbeitsdienst-Lager der Evangelisch-sozialen Schule Spandau in Falkenwalde bei Stettin.53 Sie selbst stellt die weiteren Ereignisse rückblickend so dar:
Anfang August sollte ich in Vertretung von Frau Ebart54 vor einem Kreis pommerscher Pfarrer über meine Eindrücke im Lager berichten. Ich trug in aller Offenheit die Erfahrungen, die ich gemacht hatte und die Schlüsse, die ich daraus zog, vor. Bei der gleichen Tagung sprach auch die Referentin für Frauenarbeit an der Landwirtschaftskammer Pommern, Frau Dr. Änne Sprengel, die von der körperlichen und seelischen und fachlichen Not der pommerschen Siedlerfrauen berichtete: sie forderte für die von der Landwirtschaftskammer eingesetzten Siedlungshelferinnen tätige, praktische Unterstützung. Diese jungen landwirtschaftlichen Lehrerinnen zerbrachen fast unter der körperlichen Strapaze, die ihnen abgefordert wurde. Sie brauchten – ach so bitter nötig – helfende Hände.55
Gegenüber den bisherigen Tätigkeiten im weiblichen Arbeitsdienst äussert sich Elisabeth Eckert bei dieser Gelegenheit angeblich kritisch, Thea Iffland erinnert sich 45 Jahre später so:
Sie habe statt dessen eine Aufgabe auf dem Lande im Auge, sie suche eine Arbeit unmittelbar zur Hilfe für die dortigen Menschen. Sie glaube, so würden die Mädchen weit mehr angesprochen und gefordert werden. Alles würde erzieherisch viel effektvoller sein.56
An dieser Darstellung gibt es einiges zu kritisieren, zunächst jedoch zu der Tagung selbst. Die Angabe dazu, also sowohl Zeit als auch Ort und die Schilderung ihres Vortrags sowie ihres Zusammentreffens mit Aenne Sprengel gehen einzig auf Elisabeth Eckert zurück. Es gibt hierfür keine zweite Quelle, weitere Bezüge auf diese Begegnung referenzieren direkt oder indirekt auf Elisabeth Eckert, so die Passage bei Thea Iffland oder der entsprechende Hinweis bei Dagmar Morgan.57 Es konnte trotz intensiver Recherche kein Tagungsbericht o.ä. gefunden werden, der Elisabeth Eckert und Aenne Sprengel im Spätsommer 1932 bei der gleichen Veranstaltung verortet – was nicht heißen muss, dass eine solche nicht stattgefunden hat, es liegt jedoch kein neutraler Beleg hierfür vor. Dagegen gibt es zwei Tagungen, über die Berichte vorliegen, die dem entsprechen, was Elisabeth Eckert als Kontext angibt und die damit als Ort des Zusammentreffens infrage kommen:
1. Ein im Archiv der deutschen Frauenbewegung im Bestand des Deutschen Evangelischen Frauenbundes archivierter Text mit dem Titel Weiblicher Arbeitsdienst. Umschulung weibl. Kräfte – Einrichtung einer Siedlerinnenschule berichtet von einer Tagung im Evangelischen Oberkirchenrat in Berlin, bei der “die Möglichkeit der Umschulung von jungen Mädchen und Frauen im Wege des weiblichen Arbeitsdienstes mit dem Ziel, sie späterhin als Landarbeiterinnen oder Siedlerfrauen unterzubringen” erörtert wurde. Bei dieser Tagung informieren Vertreter:innen der Evangelisch-Sozialen Schule über ihre Erfahrungen mit dem Arbeitsdienst. Es heißt im Bericht weiter, “es ist sehr zu begrüssen, dass damit die Arbeit des freiwilligen weiblichen Arbeitsdienstes über Flick- und Näharbeiten hinaus zu dem grossen Ziel der Umstellung der Frau auf ihre eigentlichen Aufgaben in der heutigen Zeit kommen wird.” Der Text ist handschriftlich mit “24.V.32” datiert.58
2. Die Jahresversammlung des Provinzialvereins für Innere Mission, die vom 3. bis 5. September 1932 in Gollnow, etwa 20 km nördlich von Stettin, stattfand.59 Eine Ankündigung der Veranstaltung findet man im Kirchlichen Amtsblatt für der Kirchenprovinz Pommern vom 23.08.1932.60 Die geplante Tagesordnung sah u.a. für Montag, 5.9., nachmittags 3:30 Uhr eine “Mitgliederversammlung im Gemeindehause” vor, bei der “1. Der freiwillige Arbeitsdienst und seine Aufgaben für die Siedlung” behandelt werden sollten, die Leitung der Diskussion hatte Paul Gerhard Braune, Leiter der Hoffnungstaler Anstalten inne.61 “Anschließend Aussprache.” Dass das Johannesstift (d.h. die Evangelisch-Soziale Schule Spandau) bei der Tagung anwesend war, ergibt sich daraus, dass bereits am Vortag eine Ansprache von Wilhelm Philipps, Vorsteher des Johannesstifts vorgesehen war.
Falls ein Zusammentreffen von Elisabeth Eckert und Aenne Sprengel im Rahmen einer Tagung, bspw. in Gollnow Anfang September 1932 stattgefunden hat – was durchaus denkbar ist, angesichts dessen, dass Aenne Sprengel fast jede Gelegenheit, ihre Arbeit vorzustellen, wahrnahm – bleibt die Frage des angeblichen Verständnisses zwischen den beiden Frauen bzgl. der Aufgaben des weiblichen Arbeitsdienstes und der Siedlerinnenberatung.
Aufgrund der bisher heraus gearbeiteten Positionen Aenne Sprengels hinsichtlich der Aufgabe der Siedlungshelferinnen, wie sie sich in ihren Publikationen aus dem Sommer und Herbst 1932 sowie aus dem Briefwechsel mit Herman Nohl zeigen, muss bezweifelt werden, dass sie sich im August (oder September) 1932 tatsächlich wie von Elisabeth Eckert später behauptet, positionierte. Dass sie ihre Fakten zur Überlastung der Siedlerfrauen vorgetragen und die Maßnahmen in Zusammenhang mit dem im Bezirk Köslin stattfindenden “Versuch” präsentiert hat, mag sein, im Sommer 1932 war jedoch seitens der Landwirtschaftskammer in Stettin und insbesondere von Aenne Sprengel selbst, noch keine Rede davon, dass die 9 (!) bisher eingesetzten Siedlungshelferinnen in maßgeblicher Form praktische Hilfe in den von ihnen betreuten Siedlungen benötigten. Vielmehr wurde händeringend nach einer Anschlussfinanzierung für das Vorhaben, in weiteren Siedlungen Beraterinnen und Kindergärten zu etablieren, gesucht, nur in dieser Form war der Arbeitsdienst eine interessante Option für Aenne Sprengel.
Weiterhin kann aufgrund der Aussagen Thea Ifflands, die, wie bereits dargestellt, später schreibt, dass “[g]elegentlich eines Treffens in Stettin, […] erörtert [wurde], wie weit die gesetzlichen, die organisatorischen und wirtschaftlichen Grundlagen den Einsatz weiblicher Arbeitsdienstlager in pommerschen Siedlungen erlaubten”, klar festgelegt werden, dass diese Idee schon im Juni in Stettin diskutiert und dann im Laufe des Sommers 1932 in unterschiedlichen Kontexten aufgegriffen und ausgestaltet wurde.62 Hierbei spielte Elisabeth Eckert keine Rolle. Die Überlegung, über die fachliche Beratung hinaus Hilfsarbeiten in den Siedlungen durchzuführen, könnte etwa aus bereits laufenden Diskussionen heraus entstanden und entsprechend im Kontext einer Tagung in größerem Rahmen aufgebracht worden sein, war aber sicher nicht maßgebliches Argument oder sogar Forderung Aenne Sprengels zu diesem Zeitpunkt. Insbesondere die Angabe Elisabeth Eckerts, die “jungen landwirtschaftlichen Lehrerinnen [wären] fast unter der körperlichen Strapaze, die ihnen abgefordert wurde” zerbrochen, findet sich so in keiner zeitgenössischen Aussage der vor Ort in Pommern mit dem Thema befassten Personen.
Die Ursprünge der Idee, den weiblichen Arbeitsdienst in Siedlungen einzusetzen, liegen im Sommer 1932, allerdings nicht punktuell im Rahmens eines einzelnen Zusammentreffens zweiter Personen. Es handelte sich um eine Diskussion, die sich über mehrere Wochen hin in einem Kontext und unter Beteiligung unterschiedlicher Akteur:innen entwickelte, die ihre je eigenen Sichtweisen einbrachten. Vielleicht war es so, dass aus dem Bedürfnis heraus, für ein konkretes Lager (das von Elisabeth Eckert geleitete) neue Einsatzmöglichkeiten zu finden, in Verbindung mit der Überlegung, den Arbeitsdienst als Finanzierungsinstrument für die Unterstützung der Siedlerfrauen zu nutzen, die Idee einer generellen Verwendung von Arbeitswilligen in Siedlungen entstand.
Zur Organisation des weiblichen Arbeitsdienstes im Herbst 1932
Die Rolle Elisabeth Eckerts soll nicht grundsätzlich kleingeredet werden, denn es kam im Herbst 1932 tatsächlich zu einer Kooperation zwischen der Evangelisch-Soziale Schule und der Landwirtschaftskammer Pommern bei der Etablierung weiterer Lager des weiblichen Arbeitsdienstes. Thea Iffland und die von ihr koordinierten Siedlerberaterinnen steuerten das Wissen darüber bei, wo ein Einsatz des Arbeitsdienstes sinnvoll wäre, die Evangelisch-Soziale Schule übernahm die Organisation der sogenannten Arbeitsdienstwilligen, “die Leitung der Lager […] und Unterkünfte für Stammlager […], in denen die Arbeitswilligen […] auf ihre Aufgabe vorbereitet werden sollten”.63 Diesen entscheidenden praktischen Schritt hat Elisabeth Eckert sicher begleitet oder sogar in die Wege geleitet – und die Basis hierfür wurde im Sommer 1932 gelegt.
Die Umsetzung von Maßnahmen des weiblichen Arbeitsdienstes erfolgte als Kooperation zwischen zwei unterschiedlichen Organisationen, dem sogenannten “Träger der Arbeit” und dem “Träger des Dienstes”. Dem Träger der Arbeit fiel dabei im Prinzip die Aufgabe des Controllings zu:
Er muss nach dem Umfang des geplanten Arbeitsvorhabens die Zahl der Dienstwilligen und die Dauer der Maßnahme nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten berechnen und alsdann den erforderlichen Aufwand mit dem erwarteten Arbeitsergebnis vergleichen und sich kritisch mit dem gegenseitigen Verhältnis auseinandersetzen. Die Sicherung der Wirtschaftlichkeit erfordert bei den Maßnahmen für Mädchen erhöhte Aufmerksamkeit, weil hier erfahrungsgemäß der Träger der Arbeit die Verbände der Wohlfahrtspflege sind, die in ihrem sonstigen Wirkungskreis nicht so strikt an die Gesetze rationeller Wirtschaftsführung gebunden sind.64
Demgegenüber organisierte der Träger des Dienstes, i.d.R. “eine[r] weltanschaulich gebundene[n] Jugendorganisation, ein[es] Frauenverbande[s], eine[r] örtliche[n] Jugendpflegevereinigung und ähnliche[r] Gemeinschaften, die den Geist der Gruppe bestimmen”, den praktischen Einsatz vor Ort und insbesondere die Struktur der Lager.65 Thea Iffland beschreibt die in den kommenden Monaten für Pommern ausgearbeiteten organisatorischen Details so:
Als Träger des Dienstes stellte sich die Ev. soz. Schule in Spandau zu Verfügung. Ein Träger der Arbeit war schwieriger zu finden, denn es sollte eine öffentlich-rechtliche Körperschaft sein. Mit den einzelnen Dörfern zu arbeiten schien zu umständlich. Da übernahm der Landwirtschaftliche Hausfrauenverein Pommern (LHV) diesen Part. Die darin zusammengeschlossenen Landfrauen waren bereit, für ihre Schwestern in den Neusiedlungen einzutreten.66
Dieser neue Akteur ist insofern interessant, als dass Aenne Sprengel Geschäftsführerin des Landwirtschaftlichen Hausfrauenvereins Pommern ist und mit dieser Wahl ihre eigene Rolle als übergreifende Koordinatorin des Unternehmens sichern kann.67 Inwiefern die im LHV Pommern organisierten Frauen allerdings in den Siedlerinnen “Schwestern” sehen, muss ebenso hinterfragt werden, wie deren Kenntnisse über die wirtschaftlichen Verhältnisse vor Ort in den Siedlungen.68 In den LHV sind, Renate Harter-Meyer zufolge “adelige Großagrarier oder Großbauern” organisiert, bzw. mit Anke Sawahn gesprochen die “Besitz- und Bildungselite vom Land” deren Erfahrungen wenig mit denen der Siedlerinnen gemein haben.69 Die LHV sind eine rechts-konservative Vereinigung, deren Ideologie u.a. die “Idealisierung von deutschem Volk und Boden, von Haus, Hof und Familie” die “Idealisierung der landwirtschaftlichen Frauenarbeit”, die “Idealisierung von deutscher Heimat, Familie, Nation und deutscher Ware” und die“Ablehnung von Demokratie, liberaler weiblicher Lebensweise und sozialen Reformen” sowie weitere revisionistische, nationalistische bis völkische Schwerpunkte hat.70
Folgt man den Ausführungen Renate Harter-Meyers, könnte ein Beweggrund für das Engagement des LHV Pommern in der Siedlerinnenhilfe – zumindest auf dem Papier – dadurch zu erklären sein, dass essentieller Bestandteil der Arbeit und des Auftretens der in den LHV organisierten Frauen ein Bild der “Harmonie der gesamten Landbevölkerung – Männer und Frauen, Großgrundbesitzer, Bauern und Landarbeiterschaft – einer organischen Wirtschaft und Gesellschaft” ist.71 Oder anders gesagt, man hält zwar bestehende soziale Schranken aufrecht, propagiert aber eine romantische Vorstellung von der gemeinsam zum Wohle des Volkes arbeitenden Landbevölkerung, was die Nationalsozialisten unter dem Schlagwort “Blut und Boden” weiterführen werden.72 Durch die Doppelfunktion Aenne Sprengels wird die tatsächliche praktische Arbeit, das Controlling, letztlich bei der Landwirtschaftskammer bzw. bei Thea Iffland in Stolp und den von ihr koordinierten Siedlerberaterinnen liegen.
Während man in Pommern beginnt, praktische Schritte zur Verbindung von Siedlerinnenberatung und weiblichem Arbeitsdienst zu unternehmen, findet Ende August 1932 im Ministerium für Volkswohlfahrt eine für die weiteren Ereignisse entscheidende Sitzung statt. Dort treffen sich “Vertreterinnen der Jugendverbände und der Berufsorganisationen, der Frauenvereine und einer Reihe öffentlicher Körperschaften” um sich “über die bisher im freiwilligen Arbeitsdienst für Mädchen gesammelten Erfahrungen” auszutauschen. Eine Meldung des Politisch-Gewerkschaftlichen Zeitungsdienstes (PGZ) fasst zusammen:
Das Ergebnis der Aussprache war die Feststellung, dass sich der Freiwillige Arbeitsdienst der Mädchen in ganz anderen Formen auswirken muss als der Arbeitsdienst der jungen Männer. Die praktischen Versuche haben ergeben, dass noch mehr als bei den jungen Männern die Gemeinschaft der Mädchen auf eine weltanschauliche Grundlage zurückgeführt werden muss. […] Im Laufe der nächsten Monate wird man die Versuche, im Wege des freiwilligen Arbeitsdienstes der Mädchen auch die Siedlung zu fördern, weiter ausbauen. […] Für die hauswirtschaftliche Unterstützung der Siedlungsfrauen, ferner für die Durchführung von Erntekindergärten und ähnlichen Massnahmen der Sommerhilfe werden geeignete Möglichkeiten des Einsatzes der jungen Mädchen gesehen.73
Wieder wird deutlich: Die Idee, den weiblichen Arbeitsdienst in den Siedlungen einzusetzen – hier sogar explizit mit dem Argument verbunden, dass die Siedlerfrauen dadurch Unterstützung erhalten könnten – liegt im Spätsommer 1932 nicht mehr länge nur in der Luft, sondern wird ganz praktisch diskutiert. So praktisch, dass Herman Nohl sich umgehend Sorgen macht, er geht in einem Brief an Hildegard von Gierke auf das Treffen ein und schreibt:
Die Zeitungsnotiz über den freiwilligen Arbeitsdienst der Mädchen und die Beratung darüber im Wohlfahrtsministerium werden Sie gelesen haben. […] Das geht natürlich auf Frau Oberregierungsrätin Mayer74 zurück. Können Sie feststellen, was da genauer dahintersteht? Die Sorge ist natürlich, dass durch eine fehlende Auslese, die gar nicht streng genug sein kann, ungeeignete Mädchen in die Siedlungen kommen und dann nur Unheil stiften. Gut wäre es aber, wenn dadurch die Mittel geschaffen werden könnten, um unsere Arbeit zu finanzieren.75
An dieser Stelle lohnt ein kurzer Rückblick auf die im vorigen Kapitel vorgestellten Publikationen des Sommers 1932 und die Schlussfolgerungen, die daraus für die Positionen Herman Nohls und Aenne Sprengels gezogen wurden. Nur so wird einerseits dessen Zurückhaltung gegenüber der Initiative des Wohlfahrtsministeriums deutlich, andererseits weshalb ich es für unwahrscheinlich halte, dass die Schilderung Elisabeth Eckerts zur Initiierung des weiblichen Arbeitsdienstes in den Siedlungen Pommerns den tatsächlichen Ereignissen entspricht.
Denn während Nohl zwar glaubt, dass viel Publizität viel bringt, ist Aenne Sprengel besorgt, dass hinsichtlich der Möglichkeiten auf dem Feld der Siedler:innenberatung falsche Erwartungen geweckt werden. Beide, Nohl wie Sprengel, sind zudem überzeugt davon, dass für die Arbeit in den Siedlungen fachlich kompetente Menschen benötigt werden – seien es sozialpädagogische Fachkräfte oder landwirtschaftlich-hauswirtschaftliche. Während man sich in Pommern zudem gerade für die Möglichkeit öffnet, den Freiwilligen Arbeitsdienst als Partner (insbesondere hinsichtlich der Finanzierung) für das laufende Projekt “Siedlerinnenberatung” mit ins Boot zu holen und während möglicherweise die ersten Abstimmungen dazu, wie dies in der Praxis aussehen könnte, laufen, galoppieren die Verbandsvertreterinnen unter Führung des Ministeriums für Volkswohlfahrt bereits davon und wollen Arbeitsdienstwillige in die Siedlungen schicken.
Hildegard von Gierke, die an der Sitzung teilgenommen hat, versucht Nohl zu beruhigen:
Frau Regierungsrätin Mayer nahm nicht daran teil. Ich habe in der Sitzung auch sehr deutlich meine Meinung gesagt, dass man sehr vorsichtig sein muss und nur wirklich gut geschulte Kräfte einsetzen darf. Man kann nicht die ganze soziale Arbeit jetzt im Wege des freiwilligen Arbeitsdienstes machen. Mir scheint eine grosse Gefahr in der Arbeit der konfessionellen Verbände zu liegen, die sich jetzt sehr intensiv auf den freiwilligen Arbeitsdienst werfen und auch den Gedanken der sozialen Arbeit haben. Er wurde von Mütterschulung in grossem Masse gesprochen. Man muss da ein sehr wachsames Auge haben, aber kann wohl schliesslich nicht viel dagegen tun.76
In seinem “Freundesbrief” vom 3. September berichtet Nohl daraufhin versöhnt bzw., wie oben bereits zitiert, vereinnahmt er die Ereignisse in typischer Nohl-Manier fast schon wieder, er behauptet “das Ministerium […] hat sich auch in einer Beratung einverstanden erklärt, den freiwilligen Arbeitsdienst dafür einzusetzen” – gemeint sind die Tätigkeiten der Siedlerberaterinnen in Pommern.77 An Hildegard von Gierke antwortet Nohl drei Tage später:
Die konfessionellen Verbände sind eine furchtbare Gesellschaft, stürzen sich auf alles und vermurxen es dann. Man kann das nur parieren durch eigene Aktivität.78
Herman Nohl, dessen nun bereits ein Jahr zurückliegender Aufsatz Landbewegung, Osthilfe und die Aufgabe der Pädagogik, so weit reichende Wellen geschlagen hat, ist im September 1932 fest davon überzeugt, dass das Programm, das er mit Aenne Sprengel, Käthe Delius und anderen ersonnen hat, erfolgreich sein kann und zwar nur so wie er es sich vorstellt.79 Die Aktivitäten anderer Gruppierungen empfindet er als störend oder kontraproduktiv, er erkennt nicht, dass die Idee der Siedler:innenberatung längst nicht mehr nur sein persönliches Nischenprojekt ist, sondern dass sich seine theoretischen Überlegungen verselbstständigt haben und dass das nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.
Siedlerinnenhilfe und Anti-Polanismus: Binow im September 1932
Trotz seiner markigen Worte gegenüber Hildegard von Gierke und trotz der Tatsache, dass nun endlich die Gelegenheit gekommen wäre, Worten Taten folgen zu lassen, befasst sich Herman Nohl weiterhin offenbar weniger mit praktischen Fragen, als vielmehr mit der Theorie des Vorhabens “Siedlerinnenberatung” – doch auch damit ist längst nicht mehr der Einzige. Ende September/Anfang Oktober 1932 findet in der Jugendherberge in Binow bei Stettin die von Werner Krukenberg bereits im Juni angekündigte Tagung des Studienkreises der Pädagogischen Akademie mit ca. 80 Teilnehmer:innen statt, darunter Irmgard Delius, Thea Iffland, Elisabeth Siegel und Aenne Sprengel.80 Nohl, dessen ideologische Linie ganz der Diskussion in Binow entspricht, ist dort selbst nicht anwesend.81 Er hält fast zeitgleich einen Vortrag bei der Heilpädagogischen Fachkonferenz in Berlin, veranstaltet vom Deutschen Archiv für Jugendwohlfahrt e.V. – diesen wird er später wiederum als Aufsatz (Der Schulkindergarten zwischen Wohlfahrtspflege und Schule) veröffentlichen, hierzu gleich mehr.82
Die Tagung in Binow wird als Ergänzung zur August-Tagung in Stolp verstanden – und da hier viele der zu diesem Zeitpunkt wesentlichen Akteur:innen in Pommern und im Bereich Siedler:innenhilfe zusammen kommen, lohnt sich ein Blick in den Tagungsbericht, aus dem insbesondere deutlich wird, wie sehr diese Vertreter:innen der sozialen Arbeit ein national-politisches Verständnis ihrer eigenen Tätigkeit haben, das sich insbesondere gegen Polen richtet.83 Polen wird im Laufe der Tagung als wirtschaftlich rückständig charakterisiert, seiner Bevölkerung ein niedriges Bildungsniveau und der politischen Führung Expansionsbestrebungen attestiert. Die Rede ist u.a. vom “Minderheitenschutz” gegenüber den in Polen “verbliebenen” Deutschen. Ein Vortragender, Wilhelm Oppermann, zuletzt gemeinsam mit Elisabeth Siegel an den Pädagogischen Akademien in Stettin und Elbing tätig, stellt die Frage, ob “ein Ausgleich zwischen Polentum und Deutschtum möglich” sei und liefert die Antwort direkt selbst: “Es erscheint ausserordentlich erschwert dadurch, dass unser deutsches Nationalbewusstsein gegenwärtig sich an den Ostfragen (Ostsiedlung) das polnische aber an den Westfragen entzündet.”84
Ähnlich wie Herman Nohl sehen die Mitglieder des Arbeitskreises in den Siedlungen des Ostens einen “Weg zur Gesundung unserer überindustrialisierten Wirtschaft”.85 Inhaltlich widmet man sich in Binow den nun schon bekannten Themen, Werner Krukenberg schildert bspw. die “gegenwärtige Lage des Freiwilligen Arbeitsdienstes mit seinen Bildungs- und Erziehungsaufgaben”. Ein weiterer Schwerpunkt der Tagung liegt, bedingt durch die hauptsächliche Tätigkeit der Teilnehmer:innen, auf den “Aufgaben ländlicher Bildungs- und Erziehungsarbeit in der Siedlung”.
Aenne Sprengel stellt ihre mittlerweile nicht mehr ganz so neuen Zahlen zum Thema “Die Frau in der Siedlung” vor, sie schildert zunächst die Rolle und Aufgaben der Siedlerfrau, die im Sommer einen Arbeitstag von bis zu 19 Stunden habe und vielfach vor ihr neuen Herausforderungen stehe. Hiervon leitet sie über zu den Aktivitäten der Landwirtschaftskammer in Ostpommern:
Seit dem Frühling dieses Jahres wurden in Pommern 12 Siedlungspflegerinnen (Siedlungsberaterinnen) eingestellt. Sie wohnen in der Siedlung und beraten die Frauen zunächst fachkundig in ihrer Wirtschaft. Darum muss die Siedlungsberaterin in Pommern die Landwirtschaft und den Osten kennen. Daneben und damit verbunden aber hat sie andere Aufgaben: Krankenhilfe, Jugendhilfsarbeit, Errichtung von Erntekindergärten usf., um so die Frauen als Mütter zu unterstützen und zu entlasten. Die Arbeit muss je nach persönlichem Können und nach den örtlichen Begebenheiten verschieden angefasst werden. Der Zusammenarbeit mit dem Lehrer, dem Pfarrer, dem Arzt usf. kommt natürlich dabei eine grosse Bedeutung zu.86
Auch hier – kein Wort hinsichtlich einer etwaigen Überforderung der Siedlungsberaterinnen noch eine Forderung nach Unterstützung in substantieller Form, es geht Aenne Sprengel um qualitative, nicht quantitative Hilfe. Ergänzend berichtet ein Walter Siebert aus Bychow, Kreis Lauenburg, von seiner Tätigkeit als Lehrer in einer Neusiedlung.87 Er betont ebenfalls die Notwendigkeit einer Unterstützung der Siedlerfrauen:
Für die Mädchen ist hauswirtschaftlicher Unterricht wichtig. Ihn gibt entsprechend ihrer Beratung der Mütter die Siedlungspflegerin. Auch im Werkunterricht hilft sie, ebenso die Fürsorgerin mit. […] In all solcher [sozialer] Arbeit [des Lehrers] ist die Siedlungspflegerin eine wichtige Hilfe und sie erfährt ihrerseits Förderung durch den Lehrer, z.B. bei der Gründung des landwirtschaftlichen Hausfrauenvereins, beim Mädchenfortbildungsunterricht. In der Erntezeit wird der Landkindergarten nötig.88
Sowohl aus diesem Bericht wie aus dem Referat Aenne Sprengels wird klar, dass die Siedlerfrauen nicht einfach Unterstützung bei der Arbeit benötigen, jemanden, der stumpf abarbeitet, obwohl eine solche sicher dankbar angenommen wird, sondern dass Hilfe in den Siedlungen – wie von Anfang an vorgesehen – eine qualitative Unterstützung durch erfahrene Fachkräfte, sei es von hausschaftlicher oder sozialpädagogischer Seite her sein sollte. Insofern ist die Orientierung hin zum freiwilligen Arbeitsdienst und seinen ungelernten, mit dem Leben in den Siedlungen nicht vertrauten Arbeitswilligen, die möglicherweise das erste Mal alleine von zuhause weg sind und selbst intensiver Betreuung bedürfen, erstmal unlogisch.89
Exkurs: Zur Situation in den Arbeitslagern
Zur Veranschaulichung der Situation in den Arbeitslagern liegt eine Schilderung von Elisabeth Eckert vor, die rückblickend von ihrer Ankunft in Falkenwalde erzählt:
Was fand ich vor: Eine kleine Jugendherberge. Wäsche zum Flicken und viele Meter grünen Stoff, aus denen Sporthemden für die Jungen eines Lagers der Evangelisch-Sozialen Schule genährt werden sollten. Eine junge Fürsorgerin, die seit zwei Monaten mit den Mädchen lebte und die Nähstube leitete. Zehn arbeitslose Mädchen aus Stettin – zehn Kilometer entfernt – im Alter zwischen 19 und 27 Jahren […]. Zwei waren Näherinnen, zwei Hausangestellte, eine Friseuse, fünf Arbeiterinnen, und alle waren lange arbeitslos. Bald kamen dazu vier Verkäuferinnen […]. Etwas neugierig aber gleichgültig wurde ich empfangen. Die Mädchen waren durch die Arbeitsämter geschickt worden. Sie konnten auf diese Weise 20 Wochen umsonst leben; als Gegenleistung hatten sie täglich 6 Stunden Näharbeit zu verrichten. Dazu waren sie bereit.90
Es ist überdeutlich, der Arbeitsdienst in seiner Form, wie er 1931 eingeführt wurde, war eine Beschäftigungsmaßnahme, weder die Organisator:innen einzelner Maßnahmen noch deren Teilnehmerinnen erwarteten mehr, als dass sie versorgt wurden und damit im Zweifel die Zeit, in der sie Arbeitslosenunterstützung erhielten, verlängern konnten. Der Dienstgedanke, die Überlegung, durch den Arbeitsdienst junge Menschen für eine größere Sache zu motivieren und dadurch einen Gemeinschaftssinn zu schaffen, also das, was in den theoretischen Diskussionen im Vordergrund steht, war unter diesen Umständen in der Praxis nicht realistisch umsetzbar. Dazu kommt, dass die in der Mehrheit ungelernten oder gering qualifizierten Teilnehmerinnen, i.d.R. städtischer Herkunft waren, keine qualifizierten Arbeitskräfte, die man in den Siedlungen einsetzen hätte können. Elisabeth Eckert bindet in ihren Rückblick auf diese Zeit, beim Verfassen Ende der 1970er Jahre, einen Auszug aus ihrem Tagebuch vom Mai 1932 ein:
In den neuen Mädchen […] habe ich Hilfe. Sie haben einmal von “SA-Freunden” gesprochen, darum werden sie von den anderen abgelehnt. Außerdem helfen sie mir im Garten, die andern wollen nicht im Garten arbeiten. Das hätte man auf dem Arbeitsamt nicht gesagt. Sie sollten nähen und den Haushalt besorgen. Von “Garten” hätte man nichts gesagt.91
Elisabeth Eckert bringt hier – neben dem Hinweis, dass die dem Nationalsozialismus zugeneigten jungen Frauen sich eher für “die Sache” einbringen als andere – den Aspekt der Erziehung ins Spiel. Die jungen Frauen werden von ihr dazu gebracht, sich mit der Gartenarbeit zu befassen – und merken, dass es Freude bringt:
Einmal hörte ich ein Gespräch im Waschraum: “Was Fräulein E. heute über die Arbeit gesagt hat, das war schön.” (“Nichts Besseres ist, denn daß der Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit.”) Ich war glücklich, daß die Mädchen zuhören und manchmal daran denken! So ist der Weg also richtig.92
Die Entwicklung hin zu einem massenhaften Einsatz von ungelernten Arbeitskräften hat – ohne hier auf die theoretischen Konzeptionen sowohl vor als auch nach 1933 weiter eingehen zu können – viel mehr mit den Absichten die am Arbeitsdienst teilnehmenden Frauen betreffend zu tun, als mit dem Objekt ihrer Tätigkeiten. Der Arbeitsdienst wird für die Teilnehmerinnen konzipiert, ihr Einsatz wird nicht nach wirtschaftlichen Aspekten bewertet, es handelt sich um billige, oft genug anspruchslose Arbeitskräfte, für die das “Erlebnis” im Mittelpunkt stehen soll und steht. Der Arbeitsdienst als Erziehungsinstrument gewinnt gegenüber dem Arbeitsdienst als Instrument der Siedlerinnenhilfe letztlich die Oberhand.93
In der Anfangsphase der Siedler:innenberatung in Pommern, als die Idee, den weiblichen Arbeitsdienst für die zusätzlich anfallenden Arbeiten einzusetzen, gerade erst aufkommt, wird durchaus noch darauf eingegangen, dass es zusätzlich zu den helfenden Händen einer fachkundige Anleitung bedarf. Ein Bericht in der Zeitschrift Mädchen formuliert den Bedarf im Frühjahr 1933 so aus:
Das wirkliche Gelingen einer Siedlung hängt zum großen Teil von der Leistung der Siedlerfrau ab, und die ist nur zu oft den großen Anforderungen, die beim Aufbau der Siedlung an sie gestellt werden, gesundheitlich kaum gewachsen. Auch hierbei ist wieder wichtig, daß die Mädchengruppe eine Führerin hat, die selber versteht, sie zu den Arbeiten anzuleiten, vielleicht auch manchmal der noch unerfahrenen Siedlerfrau mit Rat zu Hilfe zu stehen.94
Es soll nicht unterschlagen werden, dass es zeitgleich auch andere Stimmen gibt, die den weiblichen Arbeitsdienst gegensätzlich bewerten. So äussert sich der in Bethel als Mitarbeiter Friedrich von Bodelschwinghs für die Ausgestaltung eines evangelischen Arbeitsdienstes zuständige Pfarrer Gerhard Stratenwerth in einer im Frühjahr 1932 veröffentlichten Broschüre mit dem Titel Eine Bresche – Der Arbeitsdienst als Ausweg für Deutschlands Jugend aus einem Dasein ohne Hoffnung und Ziel hinsichtlich des weiblichen Arbeitsdienstes zunächst ähnlich:
Was hilft es, wenn es gelänge, große Teile unserer männlichen Welt durch den Arbeitsdienst wieder mit der Erde zu verbinden, ohne daß die rechten Frauen ihnen zur Seite stehen?95
Man müsse deshalb junge Frauen ebenso wie Männer in die Arbeit auf dem Land bringen, allerdings betont Stratenwerth, dass es sich nicht um eine Ausbildung handeln könne, denn:
Das Mädchen, dessen Bauernblut wieder durchschlägt und lebendig wird, erfaßt spielend die Aeußerlichkeiten seiner Aufgabe, an denen eine andere sich verzweifelt und vergeblich müht. Der Arbeitsdienst als Umschulung hat also auch für die weibliche Seite in erster Linie die Aufgabe, diese erste Auslese zu ermöglichen. […] Die Dienstwilligen müssen an eine Arbeit herankommen, bei der ihre körperlich und geistige Widerstandskraft mit der möglichsten Härte geprüft wird, bei der sie aber auf der anderen Seite nichts verderben können. Solche Arbeit ist für Frauen vielleicht nur im einfachen Gemüsebau zu finden. Die Bebauung von Kohl- und Bohnenfeldern könnte wohl mit weiblichen Kräften durchgeführt werden. Dabei sollte grundsätzlich der Boden nicht gepflügt, sondern mit der Hand umgegraben werden. Auch die Düngung mit natürlichem Dünger sollte mit der Hand erfolgen. Jeder mit bäuerlichen Verhältnissen Vertraute weiß, daß das eine Aufgabe ist, die oft genug von weiblichen Kräften getan wird.96
Im Gegensatz zu dem, was bspw. Aenne Sprengel und Thea Iffland (und Elisabeth Eckert) fordern, wird bei Stratenwerth explizit eine rein manuelle, beinahe “bestrafende” Arbeit für die jungen Frauen gefordert, die als Bewährung verstanden wird, um sich als Siedlerin zu qualifizieren. Die Frau als Mitarbeiterin im bäuerlichen Betrieb wird als Arbeitskraft betrachtet, der schwere und wenig attraktive Aufgaben zufallen, was von den im Arbeitsdienst auf eine solche Existenz vorzubereitenden jungen Frauen verinnerlicht werden soll. Nach Abschluss des Arbeitsdienstes sollen die jungen Frauen dann als “billige und verständnisvolle Mitarbeiterinnen”, als “Melkmägde und dergl.” in den Siedlerdörfern des Ostens eingesetzt werden.97
Mit der Ausdehnung der Diskussion ergab sich eine Vielfalt an Positionen, auf die nicht im Detail eingegangen werden kann. Ebenso wenig kann der Gedanke weiter ausgeführt werden, dass – im Gegensatz zu dem, was Stratenwerth sich vorstellt – die Ideen Aenne Sprengels, Herman Nohls u.a. eben gerade nicht darauf abzielen manuelle Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in großem Stile aufzuziehen, sondern dass ihnen an qualifizierten Teilnehmer:innen gelegen war, die man nur dann zu gewinnen können glaubte, wenn die Arbeit in den Hintergrund trat und ein anderes, ideelles Ziel mit dem Arbeitsdienst verbunden wurde.
Volk aber nichts völkisch?
Etwa ein halbes Jahr nachdem die ersten Siedlungsberaterinnen ihre Tätigkeit aufgenommen haben, ziehen die Tagungsteilnehmer:innen in Binow ein erstes, positives Fazit. Und trotz nationalistischer Untertöne findet sich im schriftlichen Resümee der Tagung der Hinweis, dass “die pädagogische Richtung nicht auf den Einzelnen, sondern auf das Volk hin” gedacht wird und dass dieses Volk “in täglichem Tun und täglicher Verantwortung [entstehe], nicht durch Züchtung völkischer Ideologien”, denn solches führe dazu, dass “das Volk in seiner realen Existenz nicht gesehen [und] zum Mittel von Parteien degradiert” werde.98
Diese Aussage ist insofern interessant, als dass der Ton wie der Inhalt der Diskussionen und Publikationen, sowohl bei den vorgestellten Tagungen des Jahres 1932 als auch im Briefverkehr zwischen Herman Nohl und den diversen Akteur:innen im Bereich Siedler:innenhilfe aus heutiger Perspektive schon sehr nach dem klingt, was die Nationalsozialisten nur kurze Zeit später lauthals in die Welt hinaus schreien werden. Das ist einerseits irritierend, weil zwar eine Reihe der beteiligten Personen durchaus – wie noch dargestellt werden wird – auch nach 1933 ihre Arbeit fortsetzen werden, einige aber eben auch nicht, weil sie den Nationalsozialisten politisch nicht genehm sind oder es auch gar nicht sein wollen. Und trotzdem klingen auch sie noch vor Januar 1933 kaum anders, als es uns nach der Machtübernahme durch die NSDAP vertraut wird. Melanie Werner fasst die heutige Irritation so zusammen: “Der Nationalismus und das Völkische Gedankengut, das uns heute zu Recht irritiert und entsetzt, war zur Zeit des Kaiserreichs gesellschaftlicher Mainstream.”99 – Auch in der Weimarer Republik kann man angesichts der analysierten Texte ergänzen.
Es zeigt sich hier zweierlei: Einmal die Bestätigung auch für dieses Arbeitsfeld, dass die Ideologie der Nationalsozialisten eben kein weltanschaulicher Fremdkörper ist, der den Deutschen am 30. Januar 1933 übergestülpt wird, sondern dass inhaltlich an bestehende Diskurse angeknüpft wird, diese im Zweifel von den Nationalsozialisten erst übernommen und dann ausgebaut werden. Zugleich muss man sich nicht wundern, dass es vielen Menschen, gerade auch in dem hier betrachteten Arbeitsbereich, nicht schwer fiel, unter der neuen Regierung weiter tätig zu sein, weil sich zunächst eben nicht viel änderte, sie ihre Arbeit fortsetzen konnten – möglicherweise sogar mit größerer staatlicher und finanzieller Unterstützung als zuvor. Da sie oft ohne nennenswerte Anpassungsforderungen ihre Projekte, die nicht nur von ihnen im Grunde als politisch neutral verstanden werden, weiter verfolgen können, findet für diese Menschen mit der Machtübernahme durch die NSDAP kein wahrnehmbarer Bruch statt. Es mag daher leicht der Gedanke aufgekommen sein, dass man sich mit den neuen Machthabern gut arrangieren könne; kleinere Konzessionen, wie beispielsweise der Gebrauch bestimmter Begriffe und der Verweis auf politisch opportune Texte und Autoren fielen dann weniger ins Gewicht angesichts einer gesicherten finanziellen Lage. Zu realisieren, dass man mit seinen Tätigkeiten nationalsozialistische Ziele unterstützte war ggf. weniger problembehaftet, als wir das rückblickend von den damaligen Akteur:innen einfordern, die sich ideologisch weitgehend mit den neuen Machthabern auf einer Linie sahen, auch ohne “Nazis” zu sein. – Und dann ist es nur noch ein kleiner Schritt dahin, sich auch mit anderen NS-Zielen und der NS-Ideologie selbst zu identifizieren.100
Zur Stellung der Frau im System der sozialen Arbeit
Wie bereits erwähnt, hält Herman Nohl, statt in Binow mit zu diskutieren, am 29. September 1932 in Berlin bei der Heilpädagogischen Fachkonferenz (Veranstalter: Deutsches Archiv für Jugendwohlfahrt e.V.) einen Vortrag, den er später unter dem Titel Der Schulkindergarten zwischen Wohlfahrtspflege und Schule zunächst im Dezember-Heft der Erziehung und dann 1949 in seinem Sammelband Pädagogik aus dreißig Jahren veröffentlicht.101 Dieser Text fällt thematisch aus der Reihe und hat vielleicht aus deshalb in der Rezeption kaum Beachtung gefunden.
Womit befasst sich Herman Nohl? Der Schulkindergarten, gemeint ist eine Art Förderklasse zwischen Kindergarten und Grundschule, für den er nach eigener Angabe “seit Jahren eine besondere Vorliebe” habe, finde Zuspruch, so stellt Nohl fest, “von zwei verschiedenen Seiten”, einig sei man sich aber über dessen “Notwendigkeit und weiter darüber, daß es sich bei ihm nicht um eine karitative Angelegenheit handelt, […] sondern um eine ganz einfache rechtliche Verpflichtung des Staates, die der Schulpflicht der Kinder entspricht.”102 Nohl argumentiert, dass die in den Schulkindergarten überwiesenen Kinder entweder körperlich noch nicht reif für die Schule, oder “geistig zurückgeblieben oder schwererziehbar” sind, was zur Folge hat, dass die eine Gruppe “pflegerisch”, d.h. “mit allen Mitteln der Jugendwohlfahrt”, die andere “propädeutisch” “auf die Schule und auf die Unterrichtsfähigkeit hinzielen[d]“ betreut werden müsse.103
Auch in diesem Text beruft sich Nohl wieder auf Fröbel, der “der erste gewesen ist, der die Aufgabe dieser Vermittlungsklasse”, als die Nohl ein solches Förderjahr betrachtet, “gesehen hat” – er schlägt daher die Bezeichnung “Fröbelklasse” vor. Eine solche Klasse solle aus praktischen Gründen und mit Blick auf die Wünsche der Kinder (!) in die Grundschule integriert werden.104 Und Nohl bringt noch ein weiteres Argument auf den Tisch: Die für den Schulkindergarten zuständigen Jugendleiterinnen würden aktuell gegenüber den Lehrer:innen schlechter gestellt, obwohl sie in der Praxis eine gleichwertige Arbeit leisten, nicht einmal die Schulferien erhielten sie, es finde ein “physische[r] [und] moralische[r] Mißbrauch eines pädagogischen Menschen” statt.105 Im Weiteren verweist Nohl dann noch auf die Anforderungen an die Ausbildung von Jugendleiterinnen für solche Schulkindergärten und die Notwendigkeit, dass hierfür durch eine enge Verbindung mit der Praxis neue Methoden entwickelt werden. Ich will aber darauf zurück kommen, wieso der Vortrag durchaus in das Wirken Herman Nohls im Jahr 1932 passt:
- Dieser Vortrag ist vielmehr eine Aufforderung zur Diskussion als dass Nohl darin seine pädagogische Theorie ausbreitet, er musste hierfür vermutlich nicht allzu viel Aufwand betreiben.
Fröbel. Nohl bleibt bei seinem Argument, dass Fröbel der Pädagoge der Stunde sei.
- Mit seinem Plädoyer, den in Schulkindergärten beschäftigten Jugendleiterinnen mehr Respekt entgegen zu bringen, bleibt Nohl bei seiner Linie: Die Pädagogik hat eine wichtige Rolle innerhalb der Gesellschaft und entsprechend auf die mit ihr Befassten.
Ungewöhnlich ist dagegen, dass Nohl weder auf die Bedeutung der Erziehung für die Gesellschaft (Stichwort Nationalpädagogik), noch auf die Rolle der Frau als Pädagogin qua Geschlecht eingeht. Insofern hat der Vortrag vom 29. September tatsächlich wenig Aussagekraft für die Themen, mit denen sich Nohl in diesen Wochen und Monaten eigentlich beschäftigt. Weshalb sich Nohl dazu entschied, an dieser Konferenz teilzunehmen, kann nicht mehr geklärt werden, vermutlich hat es mit seinen persönlichen Verbindungen zum Archiv für Jugendwohlfahrt zu tun. Umso erstaunlicher, dass er diesen aus der Reihe fallenden Text, in den allem Anschein nach nicht viel Mühe geflossen ist, in seine Sammlung der relevantesten Texte 1949 aufnimmt. Auch dazu kann nur spekuliert werden, die Vermutung liegt nahe, dass er die Neu-Publikation dazu nutzen wollte, zu zeigen, dass er sich bereits 17 Jahre zuvor mit weiterhin aktuellen Themen befasst hat – und nicht nur mit mittlerweile historischen Fragen wie dem Arbeitsdienst und der Siedlung.
Nicht zum ersten Mal stellt sich die Frage zur Position Herman Nohls gegenüber den doch mehrheitlich weiblichen Zuhörer:innen und Adressat:innen seiner Vorträge und Texte. So berichtet Nohl im Kontext der Vorbereitungen zu einer weiteren Tagung an seinen Freundeskreis:
Vom 2. bis 4. Dezember findet in Breslau eine solche mehrtägige Fröbeltagung statt, wie im August in Stolp, die Frau Luise Besser inszeniert im Verein mit den Regierungen. Das Ziel ist immer: Emporbringung der weiblichen Kräfte durch weibliche Hilfe. Die maskuline Borniertheit ist dabei erstaunlich mitanzusehen. Wie die Gockel sind diese Männer!106
Sich selbst nimmt er davon natürlich aus, Nohl vertritt schließlich wo er kann, die Sache der Frauen, es sei daran erinnert, wie er Anfang April nach der Tagung in Behle an Hans Krüger und Aenne Sprengel schrieb und sich über die fehlende weibliche Perspektive echauffierte, er brauchte, Zitat, “allerlei Energie, um den Leuten den weiblichen Gesichtspunkt verständlich zu machen” und um “den Respekt vor der weiblichen Arbeit durchzusetzen”.107
Tatsächlich liegen Nohls Positionen weit hinter dem zurück, was die zeitgenössische Frauenbewegung fordert, was aus einem Text, den Hilde Lion am 23. Oktober 1932 in der Frankfurter Zeitung veröffentlicht, deutlich wird; sie nimmt darin Stellung zur Gestaltung des weiblichen Arbeitsdienstes.108 Der Beitrag muss vor dem Hintergrund der von Vertreterinnen unterschiedlicher Frauenorganisationen erarbeiteten (und bereits vorgestellten) Denkschrift zum Arbeitsdienst betrachtet werden, Hilde Lion fasst in ihrem Artikel deren grundlegende Forderungen zusammen bzw. ordnet die Position der Vertreterinnen der weiblichen Sozialpädagogik in die aktuelle Diskussion ein.109 Deutlich wird, dass die progressiven Kräfte innerhalb der Frauenbewegung den weiblichen Arbeitsdienst als Beschäftigungsprogramm mit erzieherischen Ansprüchen, allerdings nicht als Erziehungsanstalt betrachten, Hilde Lion schreibt:
Als ideale Arbeitsform nach Ort und Arbeitsinhalt betrachten wir das Werkheim, das an sich organisch gegliedert, Küchen-, Näh-, Kinderbetrieb vereinigt und der Nachbarschaft zusätzliche sachliche und persönliche Dienste leistet in der Art eines zeitgemäßen Settlements. Daneben wird für die Stadt auch der offene Dienst als Form des weiblichen Arbeitsdienstes bleiben, d.h. die Tagesunterbringung, vor allem wegen der großen Zahl von Mädchen, die gern ‘frei’ wären, aber ihre paar Unterstützungsgroschen mit an den Familienkochtopf und an die Miete wenden müssen. Außerdem genügt diese erzieherisch vielleicht nicht so intensive Zusammenfassung für die in Frage kommenden Arbeiten.
Das Ziel des weiblichen Arbeitsdienstes sei ein emanzipatorisches, den jungen Frauen solle deutlich werden, dass und welche Möglichkeiten ihnen offen stehen:
Die Werbung für den weiblichen freiwilligen Arbeitsdienst ist keine geringe Sache. Man darf bei den hausgebundenen jungen Mädchen nicht mit allzuviel Selbstmeldung rechnen. Aber wir müssen sie auf die Chance einer neuen Lebensform aufmerksam machen, deren Bedeutung weiterreichen kann, als die 20 Wochen. […] So kann der Arbeitsdienst für die junge arbeitslose Frau ein noch nicht ganz begriffener Weg zur Freiheit in selbstgewählter Bindung werden.
Diese Vorstellung vom weiblichen Arbeitsdienst wird sich nicht durchsetzen und sie wirkt schon zeitgenössisch, d.h. im Herbst 1932, angesichts der weitaus zahlreicheren publizistischen Äußerungen, die den Arbeitsdienst als gesamtgesellschaftliche Erziehungseinrichtung imaginieren, ein wenig aus der Zeit gefallen. Eine wie auch immer geartete Emanzipation junger Frauen als ultimatives Ziel des freiwilligen Arbeitsdienstes steht zu diesem Zeitpunkt nicht zur Debatte, auch wenn nicht nur Aenne Sprengel und Käthe Delius, sondern auch Herman Nohl durchaus emanzipatorische Argumente zulassen.
Das von Nohl formulierte Ziel der an der Schnittstelle von Arbeitsdienst und Siedlungsvorhaben liegenden Aktivitäten ist denkbar verschieden von dem, was sich Hilde Lion vorstellt, jungen Frauen sollen nicht neue Chancen für ein selbstbestimmtes Leben eröffnet werden, sie sollen vielmehr in einer als traditionell weiblich definierten Sphäre miteinander und füreinander letztlich einfachste manuelle Arbeit verrichten.
Ein bisschen Reaktion
Ende Oktober ist Herman Nohl erneut in Berlin, er hält am 26. Oktober den Vortrag Pädagogische Bewegung oder pädagogische Reaktion.110 “Gegen wen sich die Rede […] politisch richtet”, sei zwar nicht eindeutig, so Benjamin Ortmeyer, es werde aber deutlich, dass, Nohl zufolge, “die Autonomie der Pädagogik […] ihre Grenzen hat”, angesichts der größeren politisch-geschichtlichen Entwicklungen.111 Den Rahmen dieses Vortrags bildet eine Veranstaltung “gegen die pädagogische Reaktion”, im Reichswirtschaftsrat, an der
sich 16 pädagogische Verbände, darunter der Deutsche Lehrerverein, der Allgemeine Deutsche Lehrerinnenverein, der Deutsche Fröbelverband, der Deutsche Verband der Sozialbeamtinnen, die Gilde Soziale Arbeit, der Arbeitskreis zur Reform der Fürsorgeerziehung und andere sozialpädagogische Vereinigungen beteiligten.112
Ob der Fröbelverband tatsächlich als Mit-Einladender auftreten sollte, wird zwischen Herman Nohl und Hildegard von Gierke Mitte September 1932 diskutiert. Hildegard von Gierke hatte wohl gegenüber Elisabeth Blochmann Kritik an dem von Nohl ursprünglich geplanten Vortragstitel (Pädagogische Bewegung oder Reaktion) geäußert, dieser schien ihr politisch sensibel, was Nohl wiederum nicht nachvollziehen kann.113 Außerdem hat er den Titel in der Zwischenzeit konkretisiert, so dass kein Missverständnis aufkommen könne (Pädagogische Bewegung oder pädagogische Reaktion). Nohl schlägt dann als Kompromiss vor, der Fröbelverband müsse nicht prominent in Erscheinung treten, wenn ihr “zu ängstlich auch bei der pädagogischen Reaktion zu Mute” sei:
Ich hatte den Fröbel-Verband zur Einladung vorgeschlagen neben dem Lehrerverein, damit er nicht vergessen wurde, aber ich nehme es in keiner Weise übel, wenn Sie sich nicht beteiligen wollen, zumal es ja schliesslich nicht meine Veranstaltung ist, ich bin ja auch nur eingeladen.114
Mit dem angepassten Titel ist Hildegard von Gierke zufrieden, es bleibt dabei, dass der Fröbel-Verband mit einlädt.115 Dem Vortrag Nohls vom 26. Oktober 1932 wird meiner Meinung nach gegenüber seinen anderen Texten aus diesem Jahr zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet, weil er sich vordergründig so eindeutig auf eine Forderung bringen lässt: “ein großer Aufruf, die pädagogischen Kräfte in der schwierigen Situation des Landes nicht zu beschneiden, sondern aufzuwerten”.116 Zu dieser Interpretation – die nicht falsch ist, aber nicht das ganze Ausmaß des Geschriebenen umfasst – trägt der Kontext bei, in dem der Vortrag gehalten wird. Christian Niemeyer, ansonsten Nohls Position in jenen Jahren gegenüber durchaus kritisch, betont z.B., dass es sich bei der Veranstaltung um eine “der letzten großen Kundgebung[en] gegen die pädagogische Reaktion” gehandelt habe; Nohls Vortrag sei gegen die spöttische Kritik an der Sozialpädagogik gerichtet (Stichwort: “Humanitätsduselei”).117
Tatsächlich beklagt Nohl in erster Linie die Etatkürzungen und weitere Sparmaßnahmen im pädagogischen Bereich, obwohl doch die Pädagogik (bzw. die Erziehung) “die beste Waffe für den Aufstieg Deutschlands” sei:
Wenn ein Volk kein anderes Kapital mehr hat als seine Menschen, ihre Lebendigkeit und ihre Zucht, dann ist die Pflege und die Erziehung dieser Menschen die primäre Aufgabe, die jeder andern vorangeht, und Politik und Wirtschaft sind von der richtigen Lösung dieser Aufgabe abhängig.118
Elisabeth Siegel platziert Nohls Vortrag in ihrer Autobiografie im Kontext der Schließung der Pädagogischen Akademien in Preußen und des allgemeinen Rückbaus im Bereich der Pädagogik, was durch dessen einführende Worte sicherlich richtig ist (“die Tatsache des äußeren und inneren Abbaus der pädagogischen Bewegung”), aber übersieht, dass Nohl entgegen seiner Beteuerung, nur aus der Sicht der Pädagogik zu sprechen, höchst politische Aussagen trifft, sie schreibt:
Für die Pädagogischen Akademien, insbesondere für die in sozialpädagogischen Fragen engagierten, erschien es als eine “große Stunde”, als Nohl in einer von der “Gilde soziale Arbeit” zusammengerufenen Versammlung im Dezember 1932 in Berlin über “Pädagogische Bewegung und pädagogische Reaktion” sprach […], gegen den Begriff der “Humanitätsduselei” und gegen Einschränkungen aller Jugendhilfemaßnahmen protestierte und im Zusammenhang mit einem Nothilfeprogramm für den Freiwilligen Arbeitsdienst statt Abbau gerade jetzt Umbau der Jugendhilfe verlangte.119
Ja, Herman Nohl verlangt einen größeren Fokus und finanzielle Sicherheit für pädagogische Institutionen, aber seine Kernbotschaft ist eine andere, was nur dann deutlich wird, wenn man sich anschaut, welche Argumente er konkret anführt und wie. Zunächst außerdem der Hinweis, dass Nohl selbst in der Veröffentlichung seiner “Osthilfe”-Aufsätze 1933 in einer Fußnote auf diesen dort nicht abgedruckten Vortrag verweist – und zwar in dem Kontext, in dem er feststellt, dass sich die Pädagogik aktuell in einer “dritten Phase” befinde.120
Ich behaupte, Pädagogische Bewegung oder pädagogische Reaktion? kann nur entschlüsselt werden, wenn man Die volkserzieherische Arbeit innerhalb der pädagogischen Bewegung kennt, insbesondere die folgende, bereits ausführlich besprochene Passage:
Sehen wir nun wieder auf die pädagogische Bewegung unserer Generation, so ist offensichtlich, daß auch hier jene dritte Phase begonnen hat, die wieder nach Gehalt und Richtung der Kräfte verlangt. Das erscheint oft wie bloße Reaktion, in Wahrheit aber ist immer das überlegene Ganze gemeint mit seiner objektiven Gewalt, das die individuellen Kräfte in Anspruch nimmt und die egoistischen in einer großen Verpflichtung bindet.121
Fast wortgleich, allerdings mit einer entscheidenden Änderung äussert sich Nohl im Oktober in Berlin (dieser zweite Text wird als erster publiziert werden):
Auch die pädagogische Bewegung unserer Generation ist jetzt in diese dritte Phase eingetreten, die wieder nach Gehalt, Richtung und Bindung der Kräfte verlangt, die oft wie bloße Reaktion erscheint, und oft auch ist, in Wahrheit aber das überlegene Ganze meint mit seiner objektiven Gewalt, das die individuellen Kräfte verpflichtet. Das Schlagwort dieser dritten Phase ist nicht mehr Persönlichkeit und Gemeinschaft, sondern “Dienst”, d.h. die tätige Hingabe an ein Objektives.122
Was sich zwischen Anfang August und Ende Oktober 1932 verändert hat, ist bezeichnend: Nohl gesteht ein, dass das, was nach Reaktion aussieht, auch Reaktion sein mag – und konkretisiert, was mit den freigesetzten individuellen Kräften geschehen soll, diese werden nicht mehr nur in Anspruch genommen, sondern verpflichtet. Damit überwiegt der Zwangscharakter, der in dieser “dritten Phase” dazu dient, das gemeinsame Große zu schaffen: Der “Dienst” wird nicht mehr (nur) freiwillig geleistet, sondern eingefordert. An dieser Stelle folgt ein langer Exkurs in das Phasenmodell, der im Prinzip 1:1 dem entspricht, was Nohl auch in Die volkserzieherische Arbeit innerhalb der pädagogischen Bewegung aufführt.123 Und dann gesteht Nohl ein, dass das, was man im Allgemeinen unter “Reaktion” versteht, nicht nur Teil der aktuellen “Phase” ist, sondern durchaus seine Berechtigung hat:
Jede Partei und jede Konfession redet heute vom Dienst. Es ist klar, daß jede dieser drei Phasen ihre eigene Form von Pädagogik mit sich bringt, ihre eigene Zielsetzung und ihre eigene Methode. Es ist aber ebenso klar, daß mit der späteren Phase die frühere nicht falsch geworden ist, sondern ihre Wahrheit in der neuen Stufe erhalten bleiben muß: Die Lebendigkeit der Kräfte ist die Voraussetzung wahrer Gemeinschaft und das Leben solcher Gemeinschaft die Voraussetzung echten Dienstes. Wer dies Entwicklungsgesetz der pädagogischen Bewegung verstanden hat, ist vor beidem geschützt: vor einer falschen Reaktion, die meint, die Einsichten der Pädagogik einfach beiseite werfen zu können, um wieder wie in der guten alten Zeit zu arbeiten. Er ist aber auch geschützt vor einer falschen Verfestigung, die die neuen Lebensformen und ihre pädagogischen Aufgaben nicht erkennt und meint, starr mit den früher gewonnenen Erziehungsmitteln ein für allemal auskommen zu können.124
Die Argument im Detail:
“Dienst” ist zum Schlagwort verkommen.
Jede Phase baut auf der vorangegangenen auf.
- Als Ausdruck von “Reaktion” wird in der aktuellen “Phase” das verstanden, was aus den vorangegangenen Phasen mitgenommen wurde.
Dabei transzendiert die “dritte Phase” die vorangegangene, deren Errungenschaften gehen in ihr auf.
- Wer sich als Anhänger einer “Reaktion” versteht, die jede Entwicklung rückgängig machen will, hat nicht verstanden, dass das nicht möglich ist.
Wer nicht verstanden hat, dass auch der aktuelle Zustand nicht endgültig ist, liegt ebenso falsch.
- Konkret bedeutet das, dass die Errungenschaften der “zweiten Phase”, deren “Bemühungen um alle, die im Staube leben, die wirtschaftlich und geistig Schwachen”, deren Fokus auf der Gemeinschaft statt dem Individuum, deren neue soziale Bewegungen wie die Frauen- und die Jugendbewegung oder der Sozialismus als das verstanden werden sollen, was sie Nohls Meinung nach sind: Ausdruck dieser “zweiten Phase” und dazu bestimmt, überwunden zu werden bzw. in dem, was die “dritte Phase” bringt, aufzugehen.125 Ein bisschen Reaktion ist gut, meint Nohl, “mag man das Biedermeierei schelten”.126 Auf aktuelle (politische) Projekte bezogen, erklärt er:
Osthilfe und Siedlung werden nie gelingen ohne den Einsatz pädagogischer Kräfte, die Landbewegung braucht vor allem eine neue ländliche Erziehung und eine wahre Dorfschule, der Wehrsport endet bestimmt mit einem Fiasko, wenn er die alten Methoden des Rekrutendrills übernehmen würde, und der Freiwillige Arbeitsdienst bleibt nur ein Augenblicksventil, wenn er nicht mit gut ausgebildeten Erziehern und einem echten pädagogischen Ethos durchgeführt wird.127
Und Nohl behauptet:
Deutschland wird die historische Aufgabe dieser Jahre nur lösen im Bunde mit der Erziehung und nur mit einer Erziehung, die dem eigensten Gesetz ihres Wesens mit heiligem Ernst die Treue wahrt, aber niemals mit einer pädagogischen Reaktion.128
Nohl nimmt damit im Prinzip voraus, was er etwa ein Dreivierteljahr später im Kreis seiner Schüler:innen als Devise ausgeben wird; Anfang August 1933 findet sich eine größere Gruppe von Student:innen und Mitarbeiter:innen Nohls zusammen, um mehr als ein halbes Jahr nach Antritt und angesichts der schon stattfindenden Verfolgungsmaßnahmen das zukünftige Verhalten gegenüber der nationalsozialistischen Regierung zu besprechen. Nohl fordert bei diesem Treffen die Gruppe dazu auf, “auf ihren Posten zu bleiben”, er geht zu diesem Zeitpunkt – wohlwollend gesprochen – davon aus, dass man sich im Bereich der Pädagogik unpolitisch halten könne.129
Bereits im Februar 1932 hatte Nohl mit fast ähnlicher Wortwahl auf den Abbau der pädagogischen Akademien durch die Preußische Regierung reagiert hatte: “In diesen Tagen scheint mir notwendiger als je vorher, daß wir auf dem Platz bleiben und arbeiten, insbesondere auch publizieren, um unsere pädagogische Stellung zu halten, damit sie die Reaktion und Schwäche überdauert. Gelingt das, so stehen wir nachher umso fester.”130 Nohls Devise, seine vorgeblich unpolitische Haltung richtet sich also tatsächlich ohne Unterschied gegen die Politik der sozialdemokratischen Regierung Preußens wie gegen – wen auch immer er im Oktober 1932 im Blick hat. Denn, so seine Feststellung, […] die pädagogische Reaktion findet sich leider in allen politischen Lagern.”131
Dieser Vortrag ist kein Zeugnis einer irgendwie gearteten Opposition gegen die sog. Reaktion oder sogar gegen den aufziehenden Nationalsozialismus, sondern vielmehr der Aufruf, sich in die politischen Ereignisse einzufügen, diese zu akzeptieren und das beste daraus zu machen. Sich “unpolitisch” verhalten bedeutet bei Nohl, sich auch nicht gegen das zu stellen, was objektiv falsch ist, solange die generelle Richtung stimmt; seine Zuhörer:innen sollen die neuen Formen und Kontexte nutzen, sich einbringen, denn “keine dieser Aufgaben ist zu lösen ohne die Mitwirkung der Pädagogik. Sie ist nirgends bloß eine Zutat, sondern steht überall im Zentrum.”132 Dass das im Umkehrschluss bedeutet, dass eine falsche Entwicklung aufgehalten werden könnte, wenn sich die Pädagogik verweigern und nicht mitarbeiten würde, scheint Nohl nicht in den Sinn zu kommen, seine Sicht, ausgedrückt im “Phasenmodell” geht von einem unaufhaltsamen Voranschreiten der Geschichte aus, das man höchstens beeinflussen, aber nicht aufhalten kann.133
Anders gesagt: Solange die Mittel nicht rückschrittlich sind, unterstützt die Erziehung jeden Ansatz zur Lösung der vielfältigen gesellschaftlichen Probleme? Spricht aus diesen Worten Naivität, oder überschätzt Nohl die eigenen Möglichkeiten, hofft er, dass man die “anderen” an die Kandare nehmen kann? Es muss ungeklärt bleiben.
Herman Nohls wunderbare Liebe für den Osten
Zwei Tage nachdem er diese Rede in Berlin gehalten hat, am 28.10., ist Herman Nohl schon wieder in Jablonken bei einer Tagung des ostpreußischen Arbeitskreises für Landschulaufbau und Landvolkerziehung, bei der er den einführenden Vortrag zum Thema Die Erziehung- und Bildungsarbeit auf dem Lande und insbesondere im Osten hält.134 Hinsichtlich der Stellung der deutschen Ostgebiete behauptet Nohl nun, den in Ostpreußen durchaus wahrgenommenen Unterschied betonend, man habe “im Reich”, “jetzt, vielleicht sehr verspätet, eine wunderbare Liebe für diesen Osten, und wenn man den Leuten erzählt, daß man nach Masuren fährt, beneiden sie einen, wie wenn man früher sagte, man fahre nach Italien”.135 Ob er damit direkt auf Gespräche in Berlin anspielt oder meint Nohl eine allgemeine Stimmung wiederzugeben?
Als Gründe für die Zusammenkunft benennt er dann (1) “die neue Besinnung auf unsere ländliche Kraft”, (2) die “Erkenntnis, daß sich hier im Osten unser deutsches Schicksal entscheidet” und (3) “die Überzeugung, daß hier […] im Kern pädagogische” Fragen zu lösen sind.136 Der deutsche Osten ist bei Nohl der “Kampfplatz der Geschichte”, er befindet sich in “Frontstellung”, muss gestärkt werden.137 Als Mittel hierfür sieht er – wie könnte es anders sein – die Pädagogik:
Das gilt ja für unser gesamtes Deutschland, seine Not fordert vor allem eine zuchtvolle Zusammennahme seiner geistigen und moralischen Kräfte, und das bedeutet letztlich Erziehung.138
Wie schon in seinem Vortrag in Stolp im August mach Nohl hier einen Gegensatz zwischen einem bisher durch Politik und Wirtschaft geführten Staat und nach dessen konstatiertem Scheitern der Notwendigkeit der Führung durch die Pädagogik auf:
[… es] wird immer klarer, daß die nationale Frage in der Lage, in der wir sind, zuallererst eine Menschenfrage ist und damit auch eine Erziehungsfrage. Das gilt im großen wie im einzelnen, z.B. beim Siedeln: Siedeln ist zu allererst ein Problem der geeigneten Menschen, des Siedlers und seiner Frau, ihres Könnens und ihrer Gesinnung und dann erst ein Problem der Wirtschaft. […] Was immer wir heute beginnen, den Wehrsport oder den Freiwilligen Arbeitsdienst – immer handelt es sich vor allem um die richtige pädagogische Gestaltung oder es bleibt ein Augenblicksventil, von dem man nicht weiß, ob es mehr schadet als nützt. Ein Volk, das kein anderes Kapital mehr hat als seine Menschen, muß sie in einer ganz anderen Weise betreuen, ihre Kraft pflegen und ihre beste Form entwickeln, wie ein reiches Volk.139
Zur Erinnerung, Nohl drückte sich zwei Tage zuvor in Berlin fast wortgleich aus:
Wenn ein Volk kein anderes Kapital mehr hat als seine Menschen, ihre Lebendigkeit und ihre Zucht, dann ist die Pflege und die Erziehung dieser Menschen die primäre Aufgabe, die jeder andern vorangeht, und Politik und Wirtschaft sind von der richtigen Lösung dieser Aufgabe abhängig.140
Es fällt auf, Nohl erwähnt mit keinem Wort, worin die Probleme, die Deutschland hat, liegen, wieso das “einzige Kapital”, das noch bleibt, “die Menschen” sind. Wie auch in seinen anderen Vorträgen des Jahres 1932 bleibt er vage, insinuiert, verwendet Schlagworte, geht davon aus, dass er sich mit seinen Zuhörer:innen auf einer gemeinsamen Verständnisebene befindet. Die zu lösenden Aufgaben werden nicht benannt, sie sind so groß, dass ihre Lösung nur in abstrakter Form skizziert werden kann. Aber – Nohl hält schließlich den einleitenden Vortrag zu einer Tagung, die sich mit Ideen für “einen ganz neuen Aufbau der Volksbildung und der Beseelung” der Menschen im Osten befassen will – er kommt doch noch zu konkreten Handlungsfeldern, die da wären:
- Die neue Dorfschule und ländliche Fortbildungsschule [… die es] aus den eigenen Bedingungen des Landes [… als] selbstständige, bodenechte, naturnahe Schule aufzubauen [gilt].
[…]
- […] Aber die Schule allein genügt nicht. Je mehr ich mich in die ländliche Welt und ihre Not vertieft habe, um so klarer ist mir geworden, daß unser im wesentlichen männliches Schulwesen durch eine weibliche Volkspflege ergänzt werden muß. […] auf dem Land, vielleicht noch mehr als in der Stadt, [ist] die Frau für das gesunde Familienleben und den kulturellen Aufbau entscheidend. Die Emporbringung unseres Volkes und seine nationale Festigung in dem nächsten Jahrzehnt wird vor allem davon abhängen, ob es uns gelingt, die weiblichen Energien zu steigern und zum vollen Einsatz ihrer Kräfte zu bringen.141
Was nimmt man daraus mit? Nun, Herman Nohl bleibt bei seinen Themen, wie könnte es anders sein, neu ist vielleicht nur, dass er so unmissverständlich davon spricht, dass Frauen einen Beitrag an der “nationalen Emporbringung” leisten können und sollen. Wichtig ist jedoch, dass er dabei nicht an Leistungen geistiger Art denkt, sondern den Bereich der Frau ganz klar absteckt, es ist die Familie, es ist die Hauswirtschaft, es sind pflegende und erzieherische Tätigkeiten. In diesem Zusammenhang geht Nohl auch auf die Dorfhelferinnen ein (so der hier genutzte Begriff), die den überlasteten Frauen zur Seite gestellt werden sollen:
Wo eine solche Frau richtig arbeitet, da geht es wie ein Kraftstrom durch das Dorf, die Frauen fühlen sich nicht mehr verlassen, sondern bekommen einen neuen Mut, die Sauberkeit in den Häusern und an den Kindern wächst, der Gesundheitszustand entwickelt sich, und in der Gemeinschaft des Dorfes entsteht eine neue Freudigkeit, ja Festbereitschaft, die niemand geahnt hat.142
Als Beleg dafür, dass diese Beschreibung nicht nur auf seiner eigenen Vorstellung beruht, zitiert Nohl dann – zumindest in der gedruckten Version des Vortrags – ausführlich aus dem Tagebuch einer Siedlungshelferin aus dem August des Jahres.143 Für die heutige Leserin zeigt sich aus diesem Auszug vor allem, wie viel Arbeit die Helferinnen (hier eine Krankenschwester und zwei Kindergärtnerinnen) leisten und weniger, dass sie dadurch einen wie auch immer gearteten pädagogischen Einfluss haben: Die Betreuung von bis zu 30 Kindern im Kindergarten, Krankenbesuche inklusive Massagen und Behandlungshinweisen, Säuglingspflege, Verarbeitung von Obst und Gemüse mit den Siedler:innen und Beratung zu dessen Anbau und Pflege, “Volkstanzabend mit den jungen Mädchen”, Vorbereitung und Durchführung eines Kinderfestes, Kommunikation mit der zuständigen Siedlungsgesellschaft und der Kreisfürsorgerin…
Zu guter Letzt nennt Nohl als weiteres Handlungsfeld
- […] die neue Weckung der pädagogischen Energie und des Bildungswillens in der ganzen Breite der Erwachsenenwelt und das richtige Aneinanderfügen aller Träger und Formen der kulturellen Arbeit in der Provinz […]. Auch hier aber erscheint mir wieder besonders wesentlich die Arbeit mit den Hausfrauenvereinen. Das eigentliche Geheimnis des ländlichen Lebens ist doch, daß der Sinn der bäuerlichen Wirtschaft und Familie zusammenfallen, daß der Sinn der bäuerlichen Wirtschaft zu allererst ist, einer Familie das Leben zu geben, und daß Mann und Frau hier in gleichem Beruf stehen. Diese einzigartige Totalität gibt der Frau eine ganz besondere Bedeutung. […] Wollen wir ländliche Erziehung treiben, werden wir nächst der richtigen Dorfschule, vor allem, ich sage es noch einmal, an die Frau denken müssen.144
Es zeigt sich erneut, wie anschlussfähig die Thesen Herman Nohls an den rechtskonservativen Diskurs Anfang der 1930er Jahre sind bzw. wie sehr seine Wortwahl der von Vertreter:innen der extremen Rechten insb. der NSDAP ähnelt. Bei Nohl ist die “Mutter und Hausfrau” – denn hierin sieht er den wesentlichen Beitrag der Frau innerhalb der Gesellschaft – “die Trägerin der Familie, und die Familie ist die eigentliche Lebenszelle des Volkes, und nur, wo diese Zellen froh und kraftvoll wirken, ist eine Nation unüberwindlich.”145 Zum Vergleich, Adolf Hitler behauptet in einer Rede “an die deutschen Frauen” auf dem Reichsparteitag der NSDAP in Nürnberg, etwa zwei Jahre später, im September 1934:
Wir empfinden es nicht als richtig, wenn das Weib in die Welt des Mannes, in seinen Hauptgebiet eindringt, sondern wir empfinden es als natürlich, in dieser beiden Welten geschieden bleiben. In die eine gehört die Kraft des Gemütes, die Kraft der Seele! Zu anderen gehört die Kraft des Sehens, die Kraft der Härte, der Entschlüsse und die Einsatzwilligkeit! In einem Fall erfordert diese Kraft die Willigkeit des Einsatzes des Lebens der Frau, um diese wichtige Zelle zu erhalten und zu vermehren, und im anderen Fall erfordert sie die Bereitwilligkeit, das Leben zu sichern, vom Manne. Was der Mann an Opfern bringt im Ringen seines Volkes, bringt die Frau an Opfern im Ringen um die Erhaltung dieses Volkes in den einzelnen Zellen. Was der Mann eingesetzt an Heldenmut auf dem Schlachtfeld, setzt die Frau ein in ewig geduldiger Hingabe, in ewig geduldigem Leiden und Ertragen.146
Trotz dieser Anschlussfähigkeit an die nationalsozialistische Idee wird aus den in Jablonken im Herbst 1932 besprochenen Ideen angesichts der veränderten politischen Rahmenbedingungen wenig. So berichtet Werner Krukenberg, der ebenfalls an der Tagung teilgenommen hat, Anfang November noch von seinen weiteren Plänen an Hans Fuchs und es wird eine gewisse Aufbruchstimmung deutlich:
Für unsere Arbeitsgemeinschaft denke ich an eine nächste Zusammenkunft noch vor Weihnachten, bei der aus den Erfahrungen dieses Sommers mit den Siedlungspflegerinnen und den Erntekindergärten berichtet werden soll und durch einen Vortrag “Wege der Landschulreform” in diesem Kreise das Gespräch über die Landesschule angebahnt werden soll. Voraussichtlich werden wir in der Provinz draussen, etwa Stolp, tagen, sodass der Stamm der Teilnehmer von der dortigen Gegend her eine Ergänzung und Belebeung [sic!] erfährt.147
Einem ähnlich optimistischen Brief Herman Nohls an Werner Krukenberg vom 8. November kann man entnehmen, dass er im Anschluss an das Treffen in Jablonken weitere Vorhaben in Königsberg besprochen hat:
Die Besprechung in Königsberg hat sich noch sehr gelohnt, es waren sämtliche führenden Frauen aus der sozialen Arbeit da, ausserdem der Direktor [der Ostmark-Klinik Albert] Kayma mit seinen Leuten und der Generaldirektor [Ernst] Nadolny von der Heimstätte[, einer gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft, S.G.].148 Sie wollen bis Ostern zunächst zwei Siedlungshelferinnen anstellen, im Frühling soll dann eine ganz grosse Tagung sein, eine öffentliche Kundgebung in Königsberg, und dann eine Zusammenkunft für zwei Tage in der Volkshochschule Rippen mit 100 bis 150 Menschen.149
Insgesamt ist Herman Nohl sehr zufrieden mit dem, was er in diesen Wochen erreicht hat, er resümiert am 22. November an den Freundeskreis:
In der Ostarbeit war ich ziemlich tätig. Die ostpreussische Tagung in Jablonken, (die zur Gründung einer ostpreussischen Arbeitsgemeinschaft für ländliche Erziehung und Bildung parallel der in Pommern, die Werner Krukenberg leitet, führte) und eine kurze Aussprache in Königsberg Ende Oktober waren recht ergiebig und sollen im Frühjahr eine Folge in einer ganz gross aufgezogenen Tagung in Rippen bei Königsberg haben.150
Soweit erkennbar wurden diese Vorhaben nicht in die Praxis umgesetzt.
Statusaufnahme November 1932
Sein hohes Arbeitspensum und seine intensive Publikationstätigkeit aus dem ersten Halbjahr 1932 hält Nohl auch in den Herbstmonaten aufrecht:
Er ist zu Tagungen in Stolp (August) mit Rundfahrt in Pommern und anschließender Reise nach Ostpreußen und zweimal in Berlin (Ende September und Ende Oktober), von wo er Ende Oktober wiederum nach Ostpreußen fährt und schließlich Anfang Dezember in Breslau – hierzu gleich mehr. Er hält drei umfangreiche Vorträge, die anschließend veröffentlicht werden (Die volkserzieherische Arbeit innerhalb der pädagogischen Bewegung in der Erziehung, Pädagogische Bewegung oder pädagogische Reaktion in Die Deutsche Schule und Die Erziehung- und Bildungsarbeit auf dem Lande und insbesondere im Osten in Die Wohlfahrt) – und korrespondiert selbstverständlich weiterhin mit zahlreichen Mitstreiter:innen, seinem Freundeskreis sowie unterschiedlichsten Amtsinhaber:innen auf allen Ebenen. In diesen Zeitraum fällt außerdem die Veröffentlichung des bereits vorgestellten Aufsatzes, Die sozialpädagogische und nationalpolitische Bedeutung der Kinderfürsorge auf dem Lande, in dem Nohl die Bedeutung des Kindergartens im Osten Deutschlands erörtert.151
Bevor Nohls weitere Aktivitäten vorgestellt werden, zunächst ein Blick auf Aenne Sprengel, die ein ähnliches Pensum vorlegt und im November einen neuen Text mit dem Titel Gedanken über die Siedlerfrauenberatung in der Zeitschrift Land und Frau veröffentlicht.152 Aenne Sprengel schildert darin die Dynamik, die das Thema in den zurückliegenden Wochen erhalten hat und verweist auf eine Reihe von Veranstaltungen, bei denen die Siedlerfrauenberatung zuletzt diskutiert wurde, u.a. die Herbsttagungen des Reichsverbandes landwirtschaftlicher Hausfrauenvereine, des Frauenbeirates des deutschen Landwirtschaftsrates und des Frauenausschusses der Hauptlandwirtschaftskammer.153
Als Ausgangslage für weitere Überlegungen will Aenne Sprengel jetzt in einem Rückblick “noch einmal die wesentlichen Punkte zur Sprache bringen”. Dies ist in ihren Augen insbesondere die Tatsache, dass es sich bei der Siedler:innenberatung nicht um eine neue Aufgabe handelt, sondern dass diese im Prinzip der Wirtschaftsberatung entspricht, wie sie in der Vergangenheit schon durchgeführt wurde – wenn auch “eine besondere und recht schwierige Spielart” derselben.154 Sie schildert diese Schwierigkeiten und betont dabei – erneut – die besondere Rolle der Frau in der Siedlung als “Betriebsleiterin und gleichzeitig Arbeitskraft […] als Mutter und Erzieherin […] als Hüterin des Lebens”. An dieser Stelle kommt dann ein für Aenne Sprengel neues Argument ins Spiel, sie verweist auf die Erzählung eines Lehrers “aus einer Siedlung dicht an der polnischen Grenze”, demzufolge die in den Siedlungen geborenen Kinder in gesundheitlich sehr schlechtem Zustand seien, “viel Krüppel, viel rachitische Kinder, viel Hilfsschultypen”. Möglicherweise bezieht sie sich damit direkt auf den Vortrag Walter Sieberts aus Bychow bei der Tagung in Binow im September.
Argumentativ ähnlich zu Nohl, allerdings ohne die nationalistischen bzw. völkischen Untertöne, macht Aenne Sprengel deutlich, wie sie sich die zukünftige Arbeit mit den Siedlerinnen vorstellt und weshalb es einer solchen Rolle innerhalb der Siedlungen bedarf:
Das Ziel der Siedlungshelferin oder Siedlerfrauenberaterin ist und kann naturgemäß nichts anderes sein als die Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Siedlerfrau im weitesten Sinne. Eine gesunde Wirtschaft ist stets die Voraussetzung für die Heranbildung einer körperlich und geistig gesunden Familie. […] Es ist uns mit Blick auf die bevölkerungs- und nationalpolitische Bedeutung der Siedlung ganz klar, daß die Siedlerwirtschaft um der Siedlerfamilie willen da ist.155
Der Text argumentiert, dass es sich bei der Siedlerfrauenberatung keineswegs um eine Form von Fürsorge handle, es sei vielmehr eine “Maßnahme zur Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie”. Diese Aussage ist insbesondere im Vergleich mit einem Beitrag, den Aenne Sprengel etwa 1,5 Jahre später veröffentlichen wird, interessant. Auf diesen wird in einem folgenden Kapitel noch ausführlich eingegangen, an dieser Stelle jedoch ein kurzer Blick in die Zukunft: Aenne Sprengel spricht im Frühjahr 1934 u.a. davon, dass “Soziale Arbeit auf dem Lande […] ‘rassenhygienische Arbeit’” sei, mit dem Ziel der “Schaffung von Bedingungen zur Aufzucht von geistig und körperlich Gesunden und Kräftigen”.156 Während Ende 1932 die Unterstützung der Siedlerinnen als wirtschaftlicher Faktor Relevanz erhalten sollte, stehen etwas mehr als ein Jahr nach der Machtübernahme durch die NSDAP deren Schlagworte im Zentrum der Argumentation, Fürsorge, bzw. Wohlfahrtspflege lehnt Aenne Sprengel dann komplett ab, da diese üblicherweise “asoziale und minderwertige Elemente” bevorzuge, anstatt sich auf den “erbgesunden Bestandteil des Volkes” zu konzentrieren. Im November 1932 hat Aenne Sprengel derlei nationalsozialistische Begrifflichkeit noch nicht in ihr Theoriekonstrukt übernommen und doch wird aus ihren zusammenfassenden Aussagen deutlich, dass eine gewisse Anschlussfähigkeit an nationalsozialistische Konzepte auch bei ihr – wie bei Nohl – vorhanden ist. Sie stellt die “körperlich und geistig gesunde Familie” in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen und macht diese nicht nur zur Grundlage ihrer Forderung nach konkreten Hilfsmaßnahmen, sondern verbindet den zu schaffenden Zustand mit nationalistischen Argumenten.
Es liegt nahe, den Text, auch wenn er in einer Fachzeitschrift erscheint, als eine Art Besitzanspruch auf Meinungshoheit zu deuten – Aenne Sprengel kann nicht nur mit Recht behaupten, dass die aktuellen Aktivitäten im Bereich der Siedlerinnenhilfe auf ihre Planung und Initiative zurück gehen, sie hat insbesondere die statistischen Daten geliefert, auf die sich die meisten anderen Autor:innen beziehen.
Zu den von Aenne Sprengel in diesem Aufsatz gelisteten Versammlungen, kommt im November 1932 eine weitere hinzu. In Berlin findet die Hauptversammlung des Reichsverbandes der Beamtinnen und Lehrerinnen in Haus, Garten und Landwirtschaft (RBL) statt. Dessen ehemalige Vorsitzende, Käthe Delius, spricht sich in einem Vortrag mit dem Titel Die Frau in der Siedlung gegen reine Frauensiedlungen aus und sie kündigt offenbar an, dass der Beginn des (weiblichen) Arbeitsdienstes in den Siedlungen des Ostens “für das Frühjahr 1933 in Vorbereitung” sei.157 Falls diese Angabe, für die kein weiterer Beleg gefunden wurde, zutrifft, bedeutet das, dass Käthe Delius, deren eigene berufliche Position zu diesem Zeitpunkt mehr als prekär ist (hierzu ausführlich im folgenden Kapitel) – und damit das von ihr repräsentierte Landwirtschaftsministerium – in die konkreten Planungen der ersten Arbeitsdienstlager in der Siedler:innenhilfe involviert waren.
Anfang Dezember (vom 2. bis 4.) findet dann eine von Herman Nohl mit-organisierte Zusammenkunft in Breslau statt. Unter den Teilnehmer:innen der Tagung, “es waren Gutsfrauen, Vertreter der Regierungen und der Selbstverwaltungskörper, Mitarbeiter caritativer Verbände und Führer des ländlich-hauswirtschaftlichen Bildungswesens, auch ländliche Schulräte und Vertreter der sozialen und pädagogischen Arbeit im engeren Sinne da”, befindet sich offenbar auch Helene Weber, die anschließend mitteilt, sie hoffe, die Tagung werde eine “nachhaltige praktische Wirkung” haben.158 Auch die Erwartung Luise Bessers geht in diese Richtung, es dürfe “nicht nur eine schöne Geste” bleiben.159
Einem Bericht Luise Bessers zu diesem Zusammentreffen, das unter dem Motto Sozialpädagogische Arbeit der Frau auf dem Lande und in der Siedlung steht, kann man zudem folgende Erwartungshaltung entnehmen:
Es gilt hier im Osten die besondere Bedeutung des Fraueneinflusses auf dem Lande zu erkennen und den Willen zu entbinden, diesem Einfluß in der Not der Zeit mit aller Energie zum Durchbruch zu verhelfen. […] Als praktisches Teilziel ergab sich aus Vorträgen und Diskussionen die Forderung von in Pommern in kleiner Anzahl schon angesetzten Helferinnen in Siedlung oder Bauerndorf, die den überbelasteten Müttern […] ja dem ganzen Dorf mütterlich zur Seite stehen sollten, als Beraterinnen bei Haus- und Feldwirtschaft, als Helferinnen bei brennenden Erziehungsfragen, als Pflegerinnen bei plötzlich eintretender Krankheitsnot.160
Nohl selbst hält in Breslau zwei Abendvorträge, davon ist zumindest einer – vermutlich – der gleiche Vortrag wie in Stolp im August (Die volkserzieherische Arbeit innerhalb der pädagogischen Bewegung).161 Er scheint allerdings auch aus seinem Vortrag in Jablonken zu schöpfen, glaubt man dem Tagungsbericht, dann erklärt er in etwa gleichlautend, dass “der Westen [dem Osten] heute seine besondere Liebe schenkt”.162
Ein Zitat aus einem Text Herman Nohls mit dem Titel Die Bedeutung der Frau und Mutter für das Deutschtum im Ausland, etwa ein halbes Jahr später in der Zeitschrift Kindergarten abgedruckt, bietet sich an, um den in diesem Kapitel behandelten Themenkomplex abzuschließen. Nohl gibt darin die folgenden Gedanken wieder:
Im Kampf der Völker entscheidet nicht der Kopf, sondern das Herz. Auch die männlichste Kraft, ihr Schaffen, Wirtschaften und Kämpfen lebt auf die Dauer wahrhaft und glücklich nur, wo ihr die eigene Familie Sinn, Halt und Bedeutung gibt, und nur die Familie ist die treue Bewahrerin der nationalen Kräfte und Gehalte, eine Familie in der die Mutter sich der Verantwortung gegen ihr Volkstum jeden Morgen wieder neu bewußt ist.163
- COD. MS. H. NOHL 797:22 Iffland, Thea, Thea Iffland an Herman Nohl, 23.07.1932 und 04.08.1932. ↩︎
- https://de.wikipedia.org/wiki/Sławno. ↩︎
- https://www.meyersgaz.org/place/21113051, hier ist die Landpflegeschwester Ruth Wentzel als Siedlungsberaterin eingesetzt, vgl. COD. MS. H. NOHL 797:22, Iffland, Thea, Thea Iffland an Herman Nohl, 12.05.1932. ↩︎
- https://www.rummelsburg.de/gemeinden/barvin/index.htm. ↩︎
- https://de.wikipedia.org/wiki/Podole_Małe, zur Siedlung in Klein Podel vgl. E. Dabs: Aus der Arbeit in Pommern – Meine Arbeit als Siedlungshelferin, in: Pommersche Wohlfahrtsblätter 9 (1933) Nr.11, S.337-340. ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 797:32, Sprengel, Aenne, Rechnung der Landwirtschaftskammer vom 19.09.1932. Ursprünglich war auch ein Besuch in den Orten Bychow (https://de.wikipedia.org/wiki/Bychowo_(Gniewino)), Ruschütz (https://de.wikipedia.org/wiki/Rzuszcze) und Gross Borkow (https://en.wikipedia.org/wiki/Borkowo_Lęborskie) vorgesehen, wo ebenfalls Siedlerberaterinnen eingesetzt sind, vgl. COD. MS. H. NOHL 797: 22, Iffland, Thea, Thea Iffland an Herman Nohl, 04.08.1932. Diese Orte liegen von Słupsk aus nach Nordosten, Richtung Gdańsk, Hin- und Rückfahrt wären weitere 160 Kilometer, auf die man offenbar verzichtete. ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 797:32, Sprengel, Aenne, Aenne Sprengel an Herman Nohl, 26.09.1932. ↩︎
- Mitteilungen, in: Pommersche Wohlfahrtsblätter 8 (1932) Nr.7, S.246f, hier S.246, vgl. auch Aus der Arbeit in Pommern, in: Pommersche Wohlfahrtsblätter 8 (1932), Nr.9, S.290-293, hier S.290. Insgesamt nahmen etwa 80 Personen an der Veranstaltung teil (S.291), laut “Freundesbrief” vom 03.09.1932 neben Nohl auch Arthur Eichler und Elisabeth Blochmann (vgl. COD. MS. H. NOHL 646G, Brief vom 03.09.1932). Zu Arthur Eichler vgl. COD. MS. H. NOHL 646G Brief vom 22.11.1932: “Dr. Arthur Eichler, zur Zeit Landschullehrer in Glambeck bei Angermünde”, vgl. auch COD. MS. H. NOHL 797:7 Besser, Luise, Herman Nohl an Luise Besser, 26.09.1932. ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 797:17, von Gierke, Hildegard, Entwurf für eine dreitägige Tagung in Stolp. Herman Nohl war es offenbar besonders wichtig, dass die Siedlungshelferinnen explizit in der Einladung erwähnt wurden, “bloss damit sie wie selbstverständlich schon in der Reihe stehen”, vgl. COD. MS. H. NOHL 797:17, von Gierke, Hildegard, Herman Nohl an Hildegard von Gierke, 16.06.1932. ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 797:17, von Gierke, Hildegard, Herman Nohl an Hildegard von Gierke, 23.05.1932. ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 797:17, von Gierke, Hildegard, Herman Nohl an Hildegard von Gierke, 06.06.1932. Nohl verweist für Thea Ifflands Expertise auf deren Artikel in Das Land, der ihrem Vortrag auf der Grünen Woche im Februar 1932 entspricht, vgl. das Kapitel “Die Besuchsreise in Pommern im Winter 1932”. ↩︎
- Hans Fuchs war zunächst Leiter des Volkshochschulheims in Jablonken, bevor er als Schulrat nach Ortelsburg wechselte, vgl. COD. MS. H. NOHL 797:32, Sprengel, Aenne, Herman Nohl an Aenne Sprengel, 10.05.1932. Zu Jablonken: https://de.wikipedia.org/wiki/Jabłonka_(Dźwierzuty) , http://www.kreis-ortelsburg.info/153/wildenau.htm und http://www.kreis-ortelsburg.info/153/fotos.htm. ↩︎
- Ursula Zielke, (geb. 1898) (https://www.archivportal-d.de/item/7OEALTCYSIVDQS24TVZICD35KQNQ5ZFL). ↩︎
- E. Dorgathen: Tagung über ‘Die volkserzieherische Aufgabe der Frau auf dem Lande und in den Siedlungen’, in: Deutsche Lehrerinnenzeitung 49 (1932), Nr.29, S.341 und Aus der Arbeit in Pommern, in: Pommersche Wohlfahrtsblätter 8 (1932) Heft 9, S.290-293. ↩︎
- https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Springorum (1892-1973). ↩︎
- s. das Kapitel “Finanzierungsfrage”, wo er als Teilnehmer des Treffens vom 13.06.1932 eingeführt wurde. Walter Nowack publizierte in den 1930er und 1940er Jahren u.a. zur bilingualen Erziehung, vgl. Bütower Kreisblatt vom 14.01.1933: “Der Schulrat Dr. Nowack in Bütow ist auf die Dauer von sechs Monaten zur Betätigung im Schulwesen der Evangelischen Kirchengemeinde Zagreb (Jugoslawien) und zwar vom 1. Januar 1933 bis 30. Juni 1933 beurlaubt worden. Die Vertretung ist dem Mittelschulrektor Meyer – Bütow übertragen worden. Bütow, den 12. Januar 1933. Der Landrat.” ↩︎
- Aus der Arbeit in Pommern Heft 9, S.291. ↩︎
- Aus der Arbeit in Pommern Heft 9, S.292, vermutlich handelt es sich um Ulrich Peiper (1894-1974), vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Peiper_(Familie). ↩︎
- Aus der Arbeit in Pommern Heft 9, S.292. Wenig verwunderlich überwiegt bei dieser Veranstaltung des Fröbelverbandes die “sozialpädagogische Fraktion” hinsichtlich der Siedlerinnenberatung. ↩︎
- (1898-1945) Später Mitglied der Bekennenden Kirche, vgl. http://grieppommer.de/texte/erinnerung_nach_60_jahren_menschen_und_schicksale_bei_kriegsende_1945/erinnerung_nach_60_jahren_menschen_und_schicksale_bei_kriegsende_1945.pdf. ↩︎
- Dorgathen. ↩︎
- Herman Nohl: Die volkserzieherische Arbeit innerhalb der pädagogischen Bewegung, in: Erziehung 8 (1933), Heft 6, S.337-346 (= Arbeit 1933, 1), auch in Herman Nohl: Landbewegung, Osthilfe und die Aufgabe der Pädagogik, Leipzig 1933, S.69-82 (= Arbeit 1933, 2) und in Herman Nohl: Pädagogik aus dreißig Jahren, Frankfurt am Main 1949, S.211-221. Aus einer Anmerkungen in der Zeitschriften-Version kann man entnehmen, dass Nohl denselben Vortrag auch im Dezember in Breslau (s.u.) gehalten hat (1933, 1 S.337 An.1). Zwischen den beiden Texten von 1933 gibt es nur kleinere Abweichungen in einzelnen Ausdrücken, die den Sinn nicht entstellen (s.u. die einzig relevante Ausnahme in An.33). In der Sammelband-Version fehlt zudem der Schlusssatz: “Mit einem Wort Fröbels: ‘Kinderpflege und Völkerpflege liegen in einem Tempel’.” (1933, 1 S.346). Der Wiederabdruck 1949 entspricht der Version des Sammelbandes von 1933. Der weitere Vortrag mit dem Titel Fröbel und die Gegenwart wurde, soweit nachvollziehbar, nicht abgedruckt. ↩︎
- Elisabeth Blochmann: Herman Nohl in der pädagogischen Bewegung seiner Zeit – 1879-1960, Göttingen 1969, S.168, vgl. dagegen Heinrich Kreis: Herman Nohl – Durch Erziehung Lebenswelt gestalten? Theoretische Rekonstruktion eines umstrittenen pädagogischen Konzeptes, Bad Heilbronn 2018, S.118 An.998, und (Nohl verteidigend) Wolfgang Klafki & Johanna-Luise Brockmann: Geisteswissenschaftliche Pädagogik und Nationalsozialismus – Herman Nohl und seine ‘Göttinger Schule’ 1932-1937, Weinheim und Basel 2002, S.298. ↩︎
- Benjamin Ortmeyer: Herman Nohl und die NS-Zeit, Frankfurt am Main 2008, S.45. ↩︎
- Das genaue Datum der Publikation seiner Aufsatzsammlung, das demnach nach März 1933 liegt könnte ggf. durch Buchbesprechungen etabliert werden, einen Hinweis geben die Anmerkungen, insb. der Hinweis auf Hans Fuchs: Erziehung zum Lande, erschienen 1933 (S.10 An.12, S.81 An.5), der sich im Zeitschriften-Aufsatz von März 1933 (1933, 1 S.345) noch nicht findet, sowie der Hinweis auf einen Aufsatz von Elisabeth Blochmann im April-Heft 1933 der Erziehung (S.80 An.4). Ob dagegen das für Juni 1933 geplante Sonderheft der Zeitschrift Kindergarten, das auf S.94 An.2 erwähnt wird, zum Zeitpunkt der Aufsatz-Publikation schon erschienen ist, kann nicht eindeutig bestimmt werden. ↩︎
- Nohl Arbeit (1933, 2) S.72. ↩︎
- Ortmeyer S.13. ↩︎
- Ortmeyer S.16f, zitiert nach Herman Nohl: Die pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie, Frankfurt am Main 1935, S.278, Hervorhebung Nohl. ↩︎
- Nohl Arbeit (1933, 2) S.74. ↩︎
- An dieser Stelle verweist Nohl auf seinen Vortrag Pädagogische Reaktion, den er Ende Oktober 1932 gehalten haben wird und der im Januar 1933 erschienen sein wird, also erst nach diesem Vortrag entsteht und insofern eine Weiterentwicklung bedeutet. (1933, 2 S.74), vgl. dazu die Ausführungen weiter unten und An.110. ↩︎
- vgl. https://www.deutschlandfunkkultur.de/tacitus-redivivus-die-grosse-trommel-leben-kampf-und-traumlallen-adolf-hitlers-100.html und https://www.mein-kampf-edition.de/?page=Pref-Book/Pref-Book_Sec8.html&term=null: “Hitler stand vor dem Nichts, als er 1924 an Mein Kampf zu schreiben begann. Von außen betrachtet schien alles verloren. Dabei hatte es doch eine Zeit lang den Anschein gehabt, als habe der Taugenichts aus der oberösterreichischen Provinz endlich seine Aufgabe und seine Rolle gefunden – als Propagandist, Demagoge, ‘Trommler’ und vielleicht sogar als neuer ‘Führer’, auf dessen Ankunft das völkische Lager schon so lange gewartet hatte.” ↩︎
- Ortmeyer S.45. ↩︎
- Nohl Arbeit (1933, 2), S.75. Im zuvor veröffentlichten Zeitschriftenbeitrag lautet der zweite Satz des zitierten Abschnittes: “Was die Jugend heute am Nationalsozialismus begeistert und jeder Erzieher in ihm bejahen muß, auch wo er seiner agitatorischen Praxis und seiner Methode der Gewalt ablehnend gegenübersteht, ist, daß…” (1933, 1 S.341). Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass Nohl den Passus zur “materialistischen Rassetheorie” erst für den Sammelband-Text ergänzt hat, weil zwischen dem Erscheinen beider Texte der Boykott jüdischer Geschäfte vom 1. April 1933 und der Erlass des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933 lagen. Auf Nohls mögliche Position hinsichtlich der antisemitischen Gesetzgebung und die Bedeutung seiner Ehe mit Bertha Oser, nach dem Gesetz “Halbjüdin”, kann hier nicht eingegangen werden. ↩︎
- Ortmeyer S.46. ↩︎
- An anderer Stelle hebt Ortmeyer hervor, dass die Aussagen Nohls hier wohl vor allen Dingen an sein eigenes Umfeld gerichtet gewesen seien, dem er deutlich machen wollte, “dass die Jugend vom Nationalsozialismus begeistert sei”. (Benjamin Ortmeyer: Mythos und Pathos statt Logos und Ethos – Zu den Publikationen führender Erziehungswissenschaftler in der NS-Zeit: Eduard Spranger, Herman Nohl, Erich Weniger und Peter Petersen, Weinheim und Basel 2009, S.209. ↩︎
- Nohl Nachwort (1933) S.94f. ↩︎
- Nohl Nachwort (1933) S.95. “Potestas (lateinisch ‘Macht’, ‘Vollmacht’, ‘Möglichkeit‘) ist ein inhaltlich zunächst unbestimmter Begriff für jede tatsächliche Beherrschungs- oder Entscheidungsmöglichkeit, den die Römer als Bezeichnung für die magistratische Gewalt im Sinne einer verfassungsrechtlich zugestandenen Verfügungsbefugnis beziehungsweise Handlungsvollmacht konkretisierten.” (https://de.wikipedia.org/wiki/Potestas) Die sog. “Gleichschaltung” war selbstverständlich weniger eine der “Herzen und Hirne”, sondern vielmehr die handfeste Eliminierung von politischer Opposition, vgl. https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/das-junge-politik-lexikon/320425/gleichschaltung/. Gleiches gilt für die “Überwindung des Partikularismus” oder anders ausgedrückt, die Aufhebung der Meinungsfreiheit. ↩︎
- Es folgt ein Mussolini-Zitat, das in der Forschung ebenfalls schon viel Aufmerksamkeit erhalten hat, vgl. Ortmeyer S.46f: “Die letzten beiden Absätze des Nachworts lassen – sozusagen in Reinkultur – erkennen, was wir an verschiedenen Stellen bei Nohl immer wieder erleben: begeisterte Zustimmung in starken Worten bei gleichzeitiger Mahnung, die pädagogische Methode nicht zu vernachlässigen.” ↩︎
- Nohl Arbeit (1933, 2), S.77. ↩︎
- Nohl Arbeit (1933, 2), S.78f. ↩︎
- Nohl Arbeit (1933, 2) S.79. ↩︎
- Nohl Arbeit (1933, 2) S.79. ↩︎
- Nohl Arbeit (1933, 2), S.80f. Es kann an dieser Stelle nicht weiter auf die Position Herman Nohls gegenüber Frauen im Allgemeinen und in Bezug auf die Frauenbewegungen im Speziellen eingegangen werden. Dazu sei bspw. Dorle Klika: Hermann Nohl – Sein „Pädagogischer Bezug” in Theorie, Biographie und Handlungspraxis, Köln (u.a.) 2000 verwiesen. Deutlich wird aber schon aus diesem kurzen Zitat, dass “die Frau” in Nohls Theorie eine besondere Stellung einnimmt, die einerseits mit großer Verantwortung verbunden ist, die sie andererseits aber klar in einem spezifisch weiblichen Kontext platziert, den sie nicht verlassen soll. ↩︎
- Nohl Arbeit (1933, 2) S.81. ↩︎
- Kreis S.120. Kreis nimmt Aussagen Nohls aus diesem Vortrag als Beleg für dessen Ablehnung des Nationalsozialismus – aufgrund dessen “agitatorische(r) Praxis, (dessen) Methode der Gewalt und (dessen) materialistische(r) Rassentheorie” [Ergänzungen Kreis], vgl. Kreis S.123. ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 646G, Brief vom 03.09.1932, Hervorhebung S.G. vgl. unten An.77. ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 646G, Brief vom 03.09.1932. Soweit bekannt gab es nur männliche Teilnehmer. ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 797:25, Krüger, Hans, Herman Nohl an Hans Krüger, 25.04.1932, vgl. den entsprechenden Hinweis im Kapitel “Die Siedlerinnenberatung nimmt Gestalt an”. Elisabeth Blochmann spricht von insgesamt drei Wochen im August (S.126). ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 646G, Brief vom 03.09.1932. Es ist nicht klar, welche Unternehmungen der bündischen Jugend Nohl meint. Bodys Studenten werden im Nachgang einen Bericht über den Aufenthalt in Masuren verfassen, der jedoch erst 1934 veröffentlicht wird: Willy Schulz und Walter Wilimzig (Hg.): Studenten auf einer Siedlung in Mauren, Langensalza 1934. Als Teilnehmer werden darin namentlich genannt: Sender, Nickel, Grabowski, Bachmann, Passt, Wegner, Papke, Böttcher, Jarinka (S.63) Der Band erschien ohne eine Namensnennung Bondys, Herman Nohl schreibt dazu an seinen “Freundeskreis”: “[…] Bondys Schrift ‘Studenten auf einer Siedlung in Masuren’, in der sein Name leider überall gestrichen werden musste, weil sich einige Mitarbeiter fürchteten mit ihm zusammen zu erscheinen! So ist die Welt manchmal heute!” (COD. MS. H. NOHL 646G, Brief vom 05.03.1934) Curt Bondy, der 1933 aufgrund seiner jüdischen Herkunft entlassen wurde und später in die USA emigrierte, kehrte nach 1945 nach Deutschland zurück und lehrte bis zu seiner Emeritierung 1959 in Hamburg Psychologie. Walter Wilimzig wurde später “Gründungsmitgl. d. BDO, Mitunterzeichner d. Gründungsdokumente u. d. ‘Aufrufes an d. dt. Generale u. Offiziere! An Volk u. Wehrmacht!’ vom 12.9.43.” (Gottfried Hamacher: Gegen Hitler – Deutsche in der Résistance, in den Streitkräften der Antihitlerkoalition und der Bewegung “Freies Deutschland”, Berlin 2005, S.213.), er wurde 1950 wegen der Misshandlung von Mitgefangenen in sowjetischer Kriegsgefangenschaft verurteilt, vgl. https://www.spiegel.de/politik/dr-walter-wilimzig-a-4c2405d6-0002-0001-0000-000044436119, https://www.spiegel.de/politik/walter-wilimzig-a-9b2c25d2-0002-0001-0000-000044449435 und https://www.spiegel.de/politik/walter-wilimzig-a-eee3b6fe-0002-0001-0000-000029194373. ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 646G, Brief vom 03.09.1932. ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 797:33, Weber, Helene, Herman Nohl an Helene Weber, 15.12.1932. ↩︎
- Morgan S.49 An.2., mit Verweis auf das “Privatarchiv Eckert”. ↩︎
- Elisabeth Eckert: Entscheidende Erfahrungen – Von den Anfängen des weiblichen Arbeitsdienstes in Pommern, in: “Mein Herz war in Pommern” – Weiblicher Arbeitsdienst, Entstehung, Entwicklung – es war eine Herausforderung, hg. von Irmgard von Boehn und Gisela Schröder-von Metzsch, Witten 1980, S.35-43, hier S.36. Möglicherweise handelt es sich um das am 1. Februar 1932 eröffnete Lager, das als das erste Mädchenlager in Pommern gilt, vgl. Organisationsberichte aus einzelnen Arbeitsbezirken, in: Deutscher Arbeitsdienst 4 (1934), Nr. 3 vom 23.01.1934, Sonderbeilage weiblicher Arbeitsdienst, S.61-65. ↩︎
- Elisabeth Ebart (1899-1979), seit 1936 verheiratete von Oppen, vgl. https://www.moz.de/lokales/eberswalde/papierfabrik-eberswalde-nachlass-der-familie-ebart-bereichert-museum-77171959.html und https://www.wikitree.com/wiki/Ebart-10. Im Januar 1933 firmiert Elisabeth Ebert [sic!] als “Reichsbeauftragte für Arbeitsdienst der evangelischen Frauenverbände”, in: Deutscher Arbeitsdienst 1933, Heft 1, Inhaltsverzeichnis, vgl. auch Elisabeth Ebart: Landwirtschaftliche Umschulung erwerbsloser Mädchen an der Evang.-sozialen Schule, Spandau, in: Evangelische Jugendführung 2 (1932), S.59-61. ↩︎
- Eckert S.41. ↩︎
- Thea Iffland: Ostpommern, seine Siedlungen und der Weg des weiblichen Arbeitsdienstes zu Arbeit und Hilfe für die Siedlerfrau, in: “Mein Herz war in Pommern” – Weiblicher Arbeitsdienst, Entstehung, Entwicklung – es war eine Herausforderung, hg. von Irmgard von Boehn und Gisela Schröder-von Metzsch, Witten 1980, S.21-32, hier S.20, die rückblickend voraus nimmt, was sich erst Ende 1932 und dann im Laufe des Jahres 1933 etablieren wird: die Ansicht, dass die Beschäftigung im Arbeitsdienst in erster Linie erzieherischen Ziele folgen soll. Dass die “Sorge” um ein Männerlager als Aufgabe des weiblichen Arbeitsdienstes nicht nur negativ bewertet wurde, wird aus einem Beitrag in der Zeitschrift Mädchen aus dem Frühjahr 1933 deutlich. Darin schreibt die nicht namentlich genannte Autorin (laut Elizabeth Harvey: Women and the Nazi East, London 2003, S.316 An.95 handelt es sich um Magdalene Keil-Jacobsen): “Zunächst kann man eine Mädchengruppe unter Leitung einer Führerin in ein Männerlager einsetzen. Die Mädchen haben dort die gesamte Wirtschaftsführung. Die Auswahl eines guten Küchenzettels, praktische und ergiebige Auswertung von Nahrungsmitteln, Wohnlichmachung der oft sehr primitiv ausgestatteten Wohnräume sind Dinge, durch die eine Mädchengruppe wesentlich zum guten Gelingen des Lagers beitragen kann.” (Gau Schlesien: Mädchen im freiwilligen Arbeitsdienst, in: Mädchen 2/3, Frühjahr 1933, S.27-29, hier S.27.) Auch ein Beitrag in Der Zwiespruch vom April 1932 stellt die Gemeinschaft von Männern und Frauen in Lagern, wobei den Frauen “wesensgemäß” die Sorge für die Männer zufällt, als angestrebtes Ideal dar. Hinter der vorgeblichen Autorin steckt, laut Peter Dudek: Erziehung durch Arbeit – Arbeitslagerbewegung und Freiwilliger Arbeitsdienst 1920-1935, Opladen 1988, Literaturverzeichnis S.293 allerdings ein Mann – Hans Richter, ein Aktivist aus dem Boberhaus-Umfeld: Lena Locator-Adders: Mädchen im freiwilligen Arbeitsdienst, in: Der Zwiespruch 14 (17.04.1932), S.170, zum Boberhaus: https://de.wikipedia.org/wiki/Boberhaus. ↩︎
- Dagmar G. Morgan: Weiblicher Arbeitsdienst in Deutschland, Darmstadt 1978, S.49 An.2. ↩︎
- AddF NL-K-16 ; L-94, S.82 unter https://www.meta-katalog.eu/Record/44585addf#?showDigitalObject=44585addf_1&c=&m=&s=&cv=81&xywh=-668,-148,6529,2939&r=). ↩︎
- https://de.wikipedia.org/wiki/Goleniów. ↩︎
- Kirchliches Amtsblatt für der Kirchenprovinz Pommern 64 (1932), Nr.13 vom 23.08.1932, S.104f. ↩︎
- Paul Gerhard Braune (1887-1954), seit 1922 Leiter der Hoffnungstaler Anstalten Lobetal, seit 1932 Vizepräsident des Zentralausschusses für die Innere Mission, er setzte sich maßgeblich gegen die sog. Euthanasie ein, vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Gerhard_Braune und https://de.wikipedia.org/wiki/Hoffnungstaler_Stiftung_Lobetal. ↩︎
- vgl. die Darstellung im vorangegangenen Kapitel “Arbeitsdienst und Siedlung”. ↩︎
- Eckert S.42. Morgan nennt für den Spätsommer 1932 vier Maßnahmen des weiblichen Arbeitsdienstes in Pommern (S.33). ↩︎
- Margarete Ehlert: Der freiwillige Arbeitsdienst der weiblichen Jugend, in: Reichsarbeitsblatt II, Nr. 33 vom 15.11.1932, S.480-483, hier S.482. ↩︎
- Hertha Siemering: Erfahrungen und Aufgabe, in: Kölner Zeitung vom 14.11.1932. ↩︎
- Iffland S.30. ↩︎
- Ortrud Wörner-Heil: Käthe Delius (1893-1977) – Hauswirtschaft als Wissenschaft, Petersberg 2018, S.139 An.217. Laut Renate Harter-Meyer “entwickelte sich eine enge Kooperation [der LHV] mit der Ministerialbürokratie” in Person Käthe Delius. (Renate Harter-Meyer: Der Kochlöffel ist unsere Waffe – Hausfrauen und hauswirtschaftliche Bildung im Nationalsozialismus, Baltmannsweiler 1999, S.98) ↩︎
- Die Landwirtschaftlichen Hausfrauenvereine setzten sich für die “Fortbildung der Hausfrauen durch gegenseitige Belehrung und Anregung, Vorträge, Besichtigungen, Ausstellungen usw.; [die] hauswirtschaftliche Ausbildung [der] Töchter und Hilfskräfte; [die] Steigerung der Produktion im Garten und Geflügelhof und erleichterte[n] Absatz dafür, bis zur Ausfuhrmöglichkeit; [die] Überbrückung der Gegensätze zwischen Stadt und Land; [die] Anerkennung der hauswirtschaftlichen Arbeit als Berufsarbeit der Hausfrauen” ein. (Harter-Meyer S.13.), vgl. grundlegend Anke Sawahn: Die Frauenlobby vom Land – Die Landfrauenbewegung in Deutschland und ihre Funktionärinnen 1898-1948, Frankfurt am Main 2009, wonach der “Organisationsschwerpunkt der Landfrauen […] auf Anerkennung ihres Landfrauendaseins als Beruf [abzielte]. […] Ihr Verband sollte unbezweifelt als Berufsorganisation akzeptiert werden, die sich auf breiter Ebene für weibliche Bildung, Ausbildung und Erwerb, für Qualifizierung, Professionalisierung und Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen auf dem Land engagieren konnte.” (S.26) Anke Sawahn urteilt über Renate Harter-Meyer, es handle sich bei deren Publikation um einen “chaotisch angelegten Text”, der viele Fehler enthalte, sie trete in “Rächerinnenpose” auf und argumentiere “affektbeladen” (S.52, auch An.178). ↩︎
- Harter-Meyer S.35, Sawahn S. 29, vgl. auch den Hinweis auf fehlende Zeit und finanzielle Mittel von Klein- und Mittelbäuerinnen als Grund für deren mangelndes Engagement in den LHV (Sawahn S.18). ↩︎
- Harter-Meyer S.59-70. ↩︎
- Harter-Meyer S.50f. ↩︎
- https://de.wikipedia.org/wiki/Blut-und-Boden-Ideologie. ↩︎
- Bundesarchiv NS5-VI-6900, Meldung P.G.Z. vom 25.08.1932. “Der ‘Politisch-gewerkschaftliche Zeitungsdienst’, der den christlichen Gewerkschaften nahe steht…” (https://library.fes.de/spdpdalt/19320514.pdf). ↩︎
- Gemeint ist wahrscheinlich Anna Meyer oder Mayer, Referentin im Ministerium für Volkswohlfahrt, vgl. https://soziales.niedersachsen.de/startseite/kinder_jugend_amp_familie/landesjugendamt/newsletter_jin/newsletter_03_2016/die-mitarbeit-der-frau-im-jugendamt-149449.html und https://www.deutscher-verein.de/de/epaper/ndv08-21/files/basic-html/page48.html. “Sie wurde 1882 geboren und verstarb […] 1937. Nachdem sie ihr Studium als Lehrerin 1917 in Berlin absolvierte, promovierte sie. Nach der Promotion zum Dr. jur. war Anna Mayer als Referendarin tätig und wurde 1926 Regierungsrätin im preußischen Ministerium für die Volkswohlfahrt. Danach hat sie im Reichsministerium des Inneren gearbeitet, doch wurde sie 1933 aus nicht bekannten Gründen entlassen. Auch war Anna Mayer ein Mitglied der DV-Bewahrungskommission, des Verbandes der Evangelischen Wohlfahrtspflegerinnen und des BDF.” (https://halloluise.de/wp-content/uploads/2019/09/Text_Mitternachtsmission_Homepageversion.pdf) Anna Meyer war laut Geschäftsverteilungsplan des Jahres 1927 in der Abteilung III zuständig für Kleinkinder-, Jugend- und Gefährdetenfürsorge sowie für die soziale Schwangeren-, Mütter- und Säuglingsfürsorge. (Paul Marcus: Das Preußische Ministerium für Volkswohlfahrt (1919-1932) – Vorgeschichte, Geschäftskreis, Tätigkeit und Auflösung sowie seine Überlieferung im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, in: Archivalische Zeitschrift 83 (2000), Nr.1, S.93-137, hier S.121), vgl. den Brief Ella Schwarz’ an Lili Droescher vom 14.06.1932: “Frau Regierungsrat Anna Mayer ist die Persönlichkeit, die am stärksten dafür interessiert ist und damit hoffentlich auch am leichtesten dafür zu gewinnen sein dürfte.” (COD. MS. H. NOHL 797:36 Nr.86-91.) ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 797:17, von Gierke, Hildegard, Herman Nohl an Hildegard von Gierke, 29.08.1932. ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 797:17, von Gierke, Hildegard, Hildegard von Gierke an Herman Nohl, 02.09.1932. ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 646G, Brief vom 03.09.1932. ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 797:17, von Gierke, Hildegard, Herman Nohl an Hildegard von Gierke, 06.09.1932. ↩︎
- vgl. Hoffmann: Landsiedlung, Landvolkbildung, Landwohlfahrt, in: Freie Volksbildung 7 (1932), S.449-452: “Nohl’s Aufsatz […], der den großen Aufgabenkreis der Pädagogik im deutschen Osten der Gegenwart umriß, hat nicht nur in Fachkreisen Widerhall gefunden. Aus seinen Gedankengängen heraus hat man z.B. jetzt unter Mitwirkung der Landwirtschaftskammer in Ostpommern eine Anzahl Siedlungspflegerinnen angesetzt, die in erster Linie für die Siedlerfrauen und ihre Familien Helferinnen auf wirtschaftlichem und pflegerischem Gebiet sein sollen.” ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 797:26, Krukenberg, Werner, Tagungsbericht: Gegenwartsaufgaben der Bildungsarbeit im deutschen Osten. Die Tagung sollte ursprünglich vom 1. bis 5. Oktober 1932 im Schullandheim in Leba, Kreis Lauenburg, stattfinden, vgl. COD. MS. H. NOHL 797:26, Krukenberg, Werner, Plan einer Arbeitstagung. Laut Tagungsbericht war der finale Termin dann 27.09.-02.10.1932. In Binow fand im Herbst/Winter 1931, also ein Jahr zuvor, eines der beiden ersten Arbeitslager für junge Frauen in Pommern statt, s.o. (Abschnitt “Finanzierungsfrage”). Zu Binow https://de.wikipedia.org/wiki/Binowo und https://www.akpool.de/ansichtskarten/28141342-ansichtskarte-postkarte-binow-pommern-jugendherberge-binow-in-der-buchheide. ↩︎
- Aus einem Brief an Hildegard von Gierke geht hervor, dass Nohl den ganzen September über “nicht kann”, vgl. COD. MS. H. NOHL 797:17, von Gierke, Hildegard, Herman Nohl an Hildegard von Gierke, 06.06.1932. ↩︎
- Die Konferenz fand am 29. und 30. September 1932 im Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht statt, Hauptthemen der Tagung waren die “Betreuung der vom Schulbesuch zurückgestellten Kinder” und die “Beschulung psychopathischer Kinder”, vgl. https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/VPTX3GMHDFYXWERALSXG3JDFHBNU6O4U. Das am 9. Juli 1923 gegründete Deutsche Archiv für Jugendwohlfahrt war eine gemeinsame Initiative der Deutschen Zentrale für freie Jugendwohlfahrt, dem Ausschuss der Jugendverbände und des Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht. Es sollte eine “Auskunft-, Sammel- und Arbeitsstelle” sein. (https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/6534/03_mkdisskapitel2.pdf?sequence=4&isAllowed=y, S.153 An.184) und https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/PYLEVDZGEC6H4U4ZVMP2FDVGNJSZK7BD?lang=en. Die Information über Nohls Vortrag findet sich in COD. MS. H. NOHL 797:33, Weber, Helene, Herman Nohl an Helene Weber, 15.12.1932. ↩︎
- Zur Abstimmung bzgl. der Tagungen im August und September vgl. COD. MS. H. NOHL 797:17, von Gierke, Hildegard, Herman Nohl an Hildegard von Gierke, 09.06.1932. ↩︎
- Zur Aufklärung: “Während in Deutschland Anfang der 1930er Jahre zur Revision der Grenzen aufgerufen wurde, mobilisierte in Polen der ‘Verteidigungsverband der Westgebiete’ (Związek Obrony Kresów Zachodnich) u. a. mit Boykottaufrufen gegen Deutschland und die deutsche Minderheit in Polen.” https://www.osmikon.de/themendossiers/shared-histories/deutsche-und-juden-als-minderheiten-in-der-zweiten-polnischen-republik-1918-1939. Wilhelm Oppermann (1896-1989) hatte bei Nohl studiert (Siegel S.79), war dann Dozent für Geschichte und Staatsbürgerkunde an der Pädagogischen Akademie in Stettin (https://de.wikipedia.org/wiki/Pädagogische_Akademie_Stettin), später Stadtschulrat in Hannover (https://www.spiegel.de/politik/die-bundesrepublik-ein-unterentwickeltes-land-a-e15b64ec-0002-0001-0000-000043366022 und https://www.igmetall-hannover.de/fileadmin/user/Geschichte/Steinbruch/Chronik_Hannover__2_1989-2003.pdf). ↩︎
- Zu Nohls genereller Ablehnung der Industrialisierung und der Großstadt vgl. Melanie Werner: Klassische Theorien Sozialer Arbeit und soziale Bewegungen, Leverkusen 2023, S.318f. Melanie Werner erklärt in diesem Kontext: “Die Kulturkritik ist ein Kommunikationszusammenhang, der Aufklärung und Industrialisierung in ihren Folgen beobachtet und in Frage stellt. Sie referiert dabei auf dem Verlust von Identität und Ganzheit in einer Inklusionsgesellschaft. Der Mensch habe sich im Zuge der Modernisierung von sich selbst entfernt, er sei nur noch Stückwerk, aber nirgendwo mehr ganz zu Hause.” ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 797:26, Krukenberg, Werner, Tagungsbericht: Gegenwartsaufgaben der Bildungsarbeit im deutschen Osten. Es muss unklar bleiben, ob jetzt tatsächlich wie geplant 12 Siedlungsberaterinnen eingesetzt waren, noch Anfang August waren es lediglich 9, s.o. die Ausführungen Thea Ifflands in Stolp (An.17). ↩︎
- Walter Siebert (geb. 1901), der selbst aus Köslin stammte, war seit 1931 Lehrer in einer einklassigen Schule in Bychow, wechselte 1937 nach Reckow und 1940 nach Gotenhafen. (BBF/DIPF/Archiv, Gutachterstelle des BIL – Preußische Volksschullehrerkartei Regierungsbezirk Köslin, GUT LEHRER (Personalunterlagen von Lehrkräften), 180924 unter https://bbf-archivdatenbank.de/actaproweb/image.xhtml?id=3bca525d-7313-4d91-8154-9b608fa76490. Mariusz Baar listet Siebert auf seiner Genealogie-Website für Reckow (Kreis Lauenburg) auf, vgl. https://reiseleiter-leba.eu/de,2,28,reckow_kr_lauenburg_pommern.html. In Reckow befand sich ab 1933 ein Lager des weiblichen Arbeitsdienstes, vgl. Reckow Herz S.89. ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 797:26, Krukenberg, Werner, Tagungsbericht: Gegenwartsaufgaben der Bildungsarbeit im deutschen Osten. ↩︎
- vgl. zur Perspektive der am Arbeitsdienst teilnehmenden Frauen Anne-Katrin Einfeldt: Zwischen alten Werten und neuen Chancen – Häusliche Arbeit von Bergarbeiterfrauen in den fünfziger Jahren, in: Lutz Niethammer (Hg.): “Hinterher merkt man, daß es richtig war, daß es schiefgegangen ist” – Nachkriegs-Erfahrungen im Ruhrgebiet Bd.2, Bonn 1983, S.149-190, hier S.157-162. ↩︎
- Eckert Herz S.36. Laut Dagmar Morgan wurden die Lager der Evangelisch-sozialen Schule Spandau üblicherweise von einer Wohlfahrtspflegerin mit Unterstützung einer landwirtschaftlichen oder hauswirtschaftlichen Lehrerin geleitet (S.47). ↩︎
- Eckert Herz S.36. Der Hinweis auf die NS-Affiliation der beiden jungen Frauen wird nochmals aufgegriffen, Elisabeth Eckert zitiert aus ihrem Tagebuch vom Juni 1932: “Ich lernte die beiden Mädels gut kennen, und trotz (oder wegen?) vieler dummer Flausen habe ich sie gern. Ihre neuen Freunde sind in der SA, ‘und wir werden auch Hitlermädel’. Vorläufig geht der Weg dazu nur über die Freunde. Ich habe sie in ihrem Wollen sehr ernst genommen und gesagt, ich erwarte von ihnen eine entsprechende Führung. – Sie waren sehr erstaunt und schwiegen dazu.” (S.38) Elisabeth Eckert steht dem Nationalsozialismus zeitgenössisch zumindest nicht unkritisch gegenüber, die beiden jungen Frauen werden gerade aufgrund ihrer Nähe zur NS-Bewegung an höheren Standards gemessen. 45 Jahre später sieht sie offenbar kein Problem darin, diese Eindrücke zu publizieren. ↩︎
- Eckert Herz S.37. Es handelt sich um ein Bibel-Zitat, Prediger 3, 18 (https://www.die-bibel.de/en/bible/LU84/ECC.3). ↩︎
- vgl. zur Theorie des (weiblichen) Arbeitsdienstes Dudek, Morgan sowie Stefan Bajohr: Weiblicher Arbeitsdienst im ‘Dritten Reich’ – Ein Konflikt zwischen Ideologie und Ökonomie, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 28 (1980), Heft 3, S.331-357, unter: https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1980_3_3_bajohr.pdf. ↩︎
- Mädchen im freiwilligen Arbeitsdienst (Gau Schlesien) S.28. ↩︎
- Gerhard Stratenwerth: Eine Bresche – Der Arbeitsdienst als Ausweg für Deutschlands Jugend aus einem Dasein ohne Hoffnung und Ziel, Bethel bei Bielefeld 1932, S.19, in BA R1501/125675, ab S.96, dort der Hinweis, dass die Broschüre im Juli 1932 an das Innenministerium übersandt wurde, was auf ihr Publikationsdatum hinweist (S.112). Gerhard Friedrich Wilhelm Stratenwerth (1898-1988) ist 1932 Leiter der westfälischen Siedlerschule, er wird am 01.01.1933 zum Referenten im Reichskommissariat für den FAD berufen (Dudek S.190). “Stratenwerth hatte sich in der Arbeitsdienstbewegung durch die Leitung eines 500 Mann starken Arbeitslagers einen Namen gemacht, das auf einem Truppenübungsplatz in der Senne ab Herbst 1931 mit Aufforstungsarbeiten beschäftigt war. Stratenwerth galt als ein Gegner der Dienstpflicht und verband den Arbeitsdienstgedanken mit weitgespannten Siedlungserwartungen.” (S.281 An.34) Laut Wolfgang Benz verfolgten die Sigmarshofer unter der Leitung von Stratenwerth ähnliche Ideen wie die Artamanen (Umschulung zum Leben auf dem Land (Benz S.329 An.49), , vgl. Gerhard Stratenwerth: Die Sigmarshofer, Bethel bei Bielefeld 1931. Stratenwerth war Mitverfasser des sog. “Betheler Bekenntnis” der Bekennenden Kirche (mit u.a. Dietrich Bonhoeffer) und Mitglied des Pfarrernotbundes (https://zeitgeschichte-hamburg.de/files/public/FZH/Publikationen_digital/Juergen%20Schmidt%20Martin%20Niemoeller%20im%20Kirchenkampf.pdf), mithin ein Gegner des Nationalsozialismus. Nach 1948 war Stratenwerth Vizepräsident des Außenamtes der EKD (https://www.hans-otto-bredendiek.de/Buch/Bredendiek/Kirchengeschichte%20links_unten_Walter%20Bredendiek.pdf). ↩︎
- Stratenwerth S.20. ↩︎
- Stratenwerth S.21. ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 797:26, Krukenberg, Werner, Tagungsbericht: Gegenwartsaufgaben der Bildungsarbeit im deutschen Osten. ↩︎
- Werner S.113. ↩︎
- Melanie Werner S.138 schreibt: “Wenn im Folgenden von Nationalismus innerhalb der Kulturkritik die Rede ist, dann soll damit nicht gesagt werden, dass die Kulturkritik insgesamt oder die mit ihr verbundenen Reformbewegungen generell nationalistisch oder völkisch gewesen seien. Mit ihrer Überbetonung von ‘Heimat‘ und ‘Volk‘, ihrem weit verbreiteten Bezug auf das ‘Germanentum’ sowie der Suche nach ‘Gemeinschaft’ bot sie völkischen und nationalistischen Gedanken jedoch einen fruchtbaren Nährboden.” ↩︎
- Herman Nohl: Der Schulkindergarten zwischen Wohlfahrtspflege und Schule, in: Pädagogik aus dreißig Jahren, Frankfurt am Main 1949, S.204-210 zuvor in: Die Erziehung 8 (1932) Heft 3, S.145-150. ↩︎
- Nohl Schulkindergarten (1949) S.204. ↩︎
- Nohl Schulkindergarten (1949) S.205. Nohl nutzt “propädeutisch” vermutlich im Sinne von “vorbereitend”, vgl. https://www.dwds.de/wb/propädeutisch. ↩︎
- Nohl Schulkindergarten (1949) S.207f. ↩︎
- Nohl Schulkindergarten (1949) S.209. Die – zumindest finanzielle – Gleichstellung von Erzieher:innen mit Grundschullehrer:innen erfolgte erst in den 1960er Jahren, vgl. Walter Thorun: Die Lage der sozialpädagogischen Arbeit und die Notwendigkeit einer Neuordnung der Ausbildung, in: Blätter des Pestalozzi-Fröbel-Verbandes 4 (1965), S.99-113. ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 646G, Brief vom 22.11.1932. Zur Organisation der Tagung: COD. MS. H. NOHL 797:7 Besser, Luise, Luise Besser an Herman Nohl, 15.09.1932, 22.09.1932, 15.12.1932, Herman Nohl an Luise Besser, 26.09.1932, 28.11.1932. Nohl firmiert bei der Veranstaltung als Mit-Einladender, vgl. COD. MS. H. NOHL 797:7 Besser, Luise, Luise Besser an Herman Nohl, 02.11.1932. ↩︎
- vgl. das Kapitel “Die ersten 12 Siedlungsberaterinnen”. ↩︎
- Hilde Lion: Die Aufgabe der Frau im freiwilligen Arbeitsdienst, in: Frankfurter Zeitung vom 23.10.1932. ↩︎
- Der freiwillige Arbeitsdienst für Mädchen – Eine Denkschrift, bearbeitet vom Deutschen Archiv für Jugendwohlfahrt und der Deutschen Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit, in: Gertrud Bäumer: Der freiwillige Arbeitsdienst der Frauen, Leipzig 1933, S.30-35, vgl. das Kapitel “Arbeitsdienst und Siedlung”. Der Text ist zum Zeitpunkt, als Hilde Lion über ihn schreibt, offenbar noch nicht veröffentlicht worden! ↩︎
- Nohl, Herman: Pädagogische Bewegung oder pädagogische Reaktion?, in: Nohl, Herman: Pädagogik aus dreißig Jahren, Frankfurt am Main 1949, S. 237–244, zuerst in: Die Deutsche Schule 37 (1933), Heft 1, S.1-6. Die Version von 1949 entspricht ohne Änderungen der ursprünglichen Version in Die Deutsche Schule. Klafki & Brockmann zeichnen die Diskussion nach, die Nohl im Vorlauf zu diesem Vortrag mit seinen Schülerinnen Erika Hoffmann und Olga von Hippel bzgl. seiner politischen Position hatte und deren Befürchtungen, dass Nohls Intentionen falsch verstanden werden könnten, vgl. Klafki & Brockmann S.49. ↩︎
- Ortmeyer Mythos S.122. ↩︎
- Nohl Reaktion (1933) S.1 An.1, vgl. http://library.fes.de/inhalt/digital/funke/pdf/1932/19321028.pdf und https://de.wikipedia.org/wiki/Vorläufiger_Reichswirtschaftsrat. ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 797:17, von Gierke, Hildegard, Hildegard von Gierke an Herman Nohl, 12.09.1932: “Mit dem Vortragstitel sind wir jetzt ganz einverstanden. Die erste Fassung hieß ‘Päd. Bewg. u. Reaktion’ u. das schien mißverständlich.” (Hervorhebung im Original.) Hildegard von Gierke kann bei der Kundgebung nicht dabei sein (vgl. Brief vom 18.10.1932), anwesend ist dagegen Olga von Hippel (Klafki & Brockmann S.50). ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 797:17, von Gierke, Hildegard, Herman Nohl an Hildegard von Gierke, 12.09.1932. ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 797:17, von Gierke, Hildegard, Hildegard von Gierke an Herman Nohl, 12.09.1932. Der Brief wurde nach Erhalt von Nohls Schreiben vom selben Tag fertig gestellt, allerdings nicht neu datiert. ↩︎
- Ortmeyer S.36. ↩︎
- Christian Niemeyer: Sozialpädagogik und Nationalsozialismus – der Fall Herman Nohl, in: Zeitschrift für Sozialpädagogik 3 (2005), S.419-431, hier S.419. ↩︎
- Nohl Reaktion S.238. ↩︎
- Elisabeth Siegel: Dafür und dagegen – Ein Leben für die Sozialpädagogik, Stuttgart 1981, S.89f, die Veranstaltung fand definitiv Ende Oktober und nicht im Dezember 1932 statt, vgl. An.112. ↩︎
- Nohl Arbeit (1933, 2) S.74 An.2: “Vgl. meinen Aufsatz Pädagogische Bewegung oder pädagogische Reaktion im Januarheft 1933 der Deutschen Schule, s.o. An.30. ↩︎
- Nohl Arbeit (1933, 2) S.74 Hervorhebung im Original. ↩︎
- Nohl Reaktion (1949) S.241f Hervorhebung (Unterstrichen) im Original, Hervorhebung (Fett) S.G.. ↩︎
- vgl. Nohl Arbeit (1949) S.213-215 und Nohl Reaktion (1949) S.240-242. ↩︎
- Nohl Reaktion (1949) S.242, Hervorhebung im Original. ↩︎
- Nohl Reaktion (1949) S.241 und Nohl Arbeit (1949) S.217. ↩︎
- Nohl Arbeit (1949) S.217. ↩︎
- Nohl Reaktion S.243. Curt Bondy, der auf dieser Veranstaltung ebenfalls spricht, erwähnt den Arbeitsdienst als pädagogisches Mittel, man müsse diesen “mit pädagogischem Geist” durchdringen, damit er nicht “gesinnungsmäßig” beeinflusst würde, vgl. http://library.fes.de/inhalt/digital/funke/pdf/1932/19321028.pdf ↩︎
- Nohl Reaktion (1949) S.244. Nohl trug seinen Text ein zweites Mal am 11. oder 12. 11.1932 im Rundfunk vor, vgl. COD. MS. H. NOHL 646G, Brief vom 22.11.1932 und Hartmut Wenzel: Elisabeth Blochmann als Lehrerbildnerin in Halle, in: Wolfgang Höffken (Hg.): Adolf Reichwein in Halle (Saale) und Lehrerbildung – Von der Pädagogischen Akademie zur Pädagogischen Fakultät, Magdeburg 2020, S.67-88, hier S.76: “Noch am 12. November 1932 setzte sich Nohl in einer Rundfunkansprache in Berlin trotz aller Sparzwänge für die Weiterführung der Pädagogischen Akademien sowie für pädagogische Reformen ein.” Klafki & Brockmann datieren den Vortrag auf den 11. November und sprechen von einer gekürzten Fassung (S.51). Hildegard von Gierke spricht von einem “Kasseler Sender”, in dem der Vortrag erfolgte, vgl. COD. MS. H. NOHL 797:17, von Gierke, Hildegard, Hildegard von Gierke an Herman Nohl, 15.11.1932. ↩︎
- Ausführlich bei Klafki & Brockmann S.118-150. ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 646G, Brief vom 10.02.1932. ↩︎
- Nohl Reaktion (1949) S.237. ↩︎
- Nohl Reaktion (1949) S.243. ↩︎
- Nohl Reaktion (1949) S.243 mit Verweis auf Hegel. ↩︎
- Herman Nohl: Die Erziehungs- und Bildungsarbeit auf dem Lande und insbesondere im Osten, in: Landschulausbau und Landvolkbildung, ein Tagungsbericht aus Jablonken vom 28. und 29. Oktober 1932 (Schriften des Ostpreußischen Arbeitskreises für Landschulausbau und Landvolkbildung, Heft 1), Königsberg 1933, S.16-22 (= 1933, 1), und in: Die Wohlfahrt, Mitteilungsblatt für Volksbildung und Wohlfahrtspflege 26 (1933), Heft 1 (= 1933, 2) und in: Herman Nohl: Landbewegung, Osthilfe und die Aufgabe der Pädagogik, Leipzig 1933, S.83-93. (= 1933, 3) Die Versionen im Tagungsbericht und im Sammelband (1933, 2 und 1933, 3) unterscheiden sich nur ganz geringfügig (Groß- und Kleinschreibung, einzelne Ausdrücke), die den Sinn nicht ändern, Ausnahmen werden im Folgenden gezeigt. Aus der Version in Die Wohlfahrt (April-Heft) geht hervor, dass es sich um einen gekürzten Abdruck der Tagungsbericht-Version handelt, u.a. werden die Tagebuch-Auszüge nicht wiedergegeben vgl. Nohl Osten (1933, 2) S.1. Der Abdruck in Die Wohlfahrt unterscheidet sich von den anderen beiden Varianten durch Hervorhebungen, die Kürzungen betreffend bspw. Nohls zivilisationskritische Ausführungen (1933, 1 S.16f). ↩︎
- Nohl Osten (1933, 3) S.83. ↩︎
- Nohl Osten (1933, 3) S.83f. ↩︎
- Nohl Osten (1933, 3) S.84. ↩︎
- Nohl Osten (1933, 3) S.84. ↩︎
- Nohl Osten (1933, 3) S.85. ↩︎
- Nohl Reaktion S.238,s.o. An. 118. ↩︎
- Nohl Osten (1933, 3) S.85-87. ↩︎
- Nohl Osten (1933, 3) S.88, in der Version aus dem Tagungsbericht steht “da geht ein Kraftstrom durch das Dorf”, vgl. Nohl Osten (1933, 1) S.18, die Variante in Die Wohlfahrt hat bereits die Änderung zu “wie ein Kraftstrom” umgesetzt. Dagegen ist das Zitat eines Spruches zur Bedeutung der Frau in der ländlichen Wirtschaft in Die Wohlfahrt analog zur Version im Tagungsbericht (“geht die ganze Wirtschaft nicht”) (1933, 1 S.22 und 1933, 2 S.2), während die Sammelband-Version anders lautet (“geht die Wirtschaft hinter sich”). ↩︎
- Da die im Bestand COD. MS. H. NOHL 797 angelegten Briefe von Siedlungshelferinnen bisher nicht ausgewertet wurden, kann nicht festgestellt werden, ob der zitierte Text sich darunter befindet und ob er authentisch ist. Aufgrund eines Hinweises in der Version im Tagungsbericht (es wird ein Siedler Schröder in Barvin erwähnt) und aufgrund der Nennung der betreuten Siedler “Krack, Schröder, König, Zessin” (1933, 2 S.19, 1933, 3 S.89) handelt es sich wahrscheinlich um das Tagebuch der Landpflegeschwester Berta Niediek aus Barvin. ↩︎
- Nohl Osten (1933, 3) S.92. ↩︎
- Nohl Osten (1933, 3) S.93. In der Version im Tagungsbericht, steht hier “die Familie ist die eigentliche nationale Zelle des Volkes, und nur, wo diese Zellen froh und lebendig wirken, ist eine Nation unüberwindlich.”, vgl. Nohl Osten (1933, 1) S.22 und Nohl Osten (1933, 2) S.2, vgl. Werner S.317f wonach es sich um ein für Nohl charakteristisches Bild der Frau als “Keimzelle der Familie” und damit “Keimzelle des Volkes” handelt. ↩︎
- Adolf Hitler: Reden an die Deutsche Frau, unter: https://ia600206.us.archive.org/12/items/RedenAnDieDeutscheFrau1934/Scholtz-klinkgertrud-RedenAnDieDeutscheFrau1934.pdf, vgl. zum Schlagwort “Keimzelle der Nation”: https://diskursatlas.de/index.php?title=Keimzelle_der_Nation. ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 797:26, Krukenberg, Werner, Werner Krukenberg an Hans Fuchs, 05.11.1932. ↩︎
- Zu den Genannten: https://www.bildarchiv-ostpreussen.de/cgi-bin/bildarchiv/suche/show_foto.cgi?lang=russki&id=43042, https://d-nb.info/361456662/04, sowie Ernst Siehr: Ostpreußische Siedlungsfragen, in: Zeitschrift für Politik 22 (1933), S. 319-340, S.328, vgl. Marawske-Birkner S.201, die von einer Organisation namens “Heimatwerk” spricht, die bereits im August 1932 eine Gruppe von jungen Frauen zur Hilfe in die Siedlung Drangsitten geschickt habe (https://de.wikipedia.org/wiki/Awgustowka). ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 797:26, Krukenberg, Werner, Herman Nohl an Werner Krukenberg, 08.11.1932. Es gab in Ostpreußen vier ländliche Volkshochschulen, in Carlshof bei Rastenburg, in Legienen bei Rößel, in Jablonken in Masuren, und in Rippen im Kreise Heiligenbeil. (https://www.ahnen-spuren.de/Members/inge4013/ostpreussische-nachrichten/ostpreussenblatt/ostpreussenblatt-1956/ostpreussenblatt-folge-28-vom-14.07.1956) ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 646G, Brief vom 22.11.1932. ↩︎
- Die sozialpädagogische und nationalpolitische Bedeutung der Kinderfürsorge auf dem Lande, in: Kindergarten, Zeitschrift des Deutschen Fröbel-Verbandes, des Deutschen Verbandes für Schulkinderpflege und der Berufsorganisation der Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen und Jugendleiterinnen e.V. (Kindergarten in Dorf und Siedlung, Sonderdruck), 73. Jg. (1932), S. 168–171, und in: Landbewegung, Osthilfe und die Aufgabe der Pädagogik, Leipzig 1933, S. 43-50, vgl. ausführlich im Kapitel “Die ersten 12 Siedlungsberaterinnen”. ↩︎
- Aenne Sprengel: Gedanken über die Siedlerfrauenberatung, in: Land und Frau 16 (1932), Nr.47, S.781 und Nr.48, S.796. ↩︎
- “1928 richtete der Deutsche Landwirtschaftsrat (DLR) nach jahrelangem Vertagen einen Frauenbeirat ein, in dem nun auch außerpreußische LHV-Verbände ein Gremium für reichseinheitliches Arbeiten bekamen.” (Sawahn S.132), vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Landwirtschaftsrat. Zu diesen Veranstaltungen konnten bisher keine weiteren Informationen gefunden werden. ↩︎
- Sprengel Gedanken S.781. ↩︎
- Sprengel Gedanken S.781. ↩︎
- Aenne Sprengel: Zeitgemäße soziale Frauenarbeit auf dem Lande unter besonderer Berücksichtigung des Siedlungswesens, in: Nationalsozialistischer Volksdienst 1 (1934), Heft 7, S.195-200, hier S.195. ↩︎
- Wörner-Heil Delius S.207. Wie im Kapitel “Die Siedlerinnenberatung nimmt Gestalt“ erwähnt, hatte Käthe Delius Anfang der 1920er Jahre auf dem von Irene von Gayl gegründeten “Sonnenhof”, einem rein weiblichen Siedlungsprojekt eigene Siedlungserfahrung gemacht und für sich u.a. die Erkenntnis gewonnen, dass “eine Frauensiedlung kein Weg” ist. (Delius Erinnerungen Teil II S.6) ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 797:33, Weber, Helene, Helene Weber an Herman Nohl, 20.12.1932. Helene Weber hielt in Breslau eine Ansprache, vgl. COD. MS. H. NOHL 797:33, Weber, Helene, Herman Nohl an Helene Weber, 15.12.1932. ↩︎
- COD. MS. H. NOHL 797:7 Besser, Luise, Luise Besser an Herman Nohl, 02.11.1932. ↩︎
- L[uise] B[esser]: Sozialpädagogische Arbeit der Frau auf dem Lande und in der Siedlung – Tagung in Breslau, in: Kindergarten 1933, S.67f, hier S.67. ↩︎
- Nohl Arbeit (1933, 1) S.337 An.1. Zur Genese der Tagung als Fortsetzung der Stolper Tagung vgl. COD. MS. H. NOHL 797:7, Besser, Luise, Luise Besser an Herman Nohl 15.09.1932, 22.09.1932, 02.11.1932, 28.11.1932 und Herman Nohl an Luise Besser, 26.09.1932. ↩︎
- Tagung in Breslau S.67. Leider konnten keine weiteren Dokumente zu dieser Tagung gefunden werden. ↩︎
- Herman Nohl: Die Bedeutung der Frau und Mutter für das Deutschtum im Ausland, in: Kindergarten 74 (1933), S.125f. ↩︎
Schreibe einen Kommentar